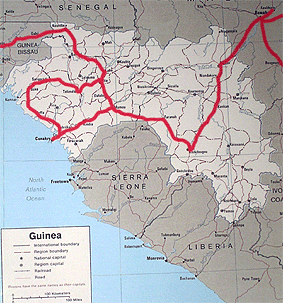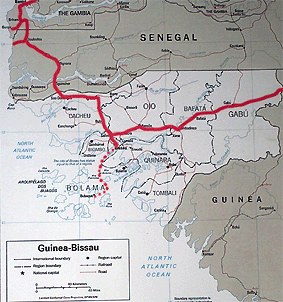
Am Sonntag schaffen wir es bis 11 Uhr an der "garage", dem hiesigen "gare routière" zu sein. Für 4500 CFA finden wir ein PKW-Buschtaxi. Es ist rappel-voll, ich habe den dämlichsten Platz auf der hinteren Rückbank in der Mitte und kann mir alle 5 Minuten überlegen, welchen Knoten mit meinen Beinen ich jetzt gerade ausprobiere.
Jeder, noch
so unfreiwillige, Stopp kommt mir da natürlich sehr entgegen.
Das Taxi holpert also los um kurz darauf erst einmal zu tanken. Das machen hier nämlich alle so und es wird natürlich nur soviel Diesel getankt, wie notwendig ist um gerade mal anzukommen. Es könnte ja sein, dass das Auto zusammenbricht und dann ist der volle Tank verlorenes Geld. Diesmal allerdings tankt er voll und der ganze Wagen stinkt nach Heizöl.
Die Strasse bis zur Grenze ist ganz gut. Auf dem kleinen Stück bis zur Grenze kommen wir auch hier an einem Massengrab für die "Joola"-Opfer vom letzten Jahr vorbei.
Die Grenzkontrollen auf senegalesischer Seite gehen schnell
und reibungslos. Nur auf der Guinea-Bissau-Seite müssen alle ihr Gepäck ausladen, vorzeigen und teilweise
auspacken. So wuchte ich also meinen schweren Rucksack zu den Kontrolleuren,
sehr jungen Soldaten, und einer will tatsächlich gaaanz tief reingucken. Ich
verfluche ihn - zum Glück versteht er mich nicht. Die Verständigung ist hier
ohnehin problematisch, da man hier entweder portugiesisch oder creole spricht.
Wir
haben den Vorteil, dass wir nur eine PKW-Besatzung sind. Ein großes
Mercedes-Busch-Taxi benötigt wohl mehr Zeit, ehe alles vom Dach gewuchtet ist.
In Ingore kommt eine zweite Kontrolle mit der gleichen Prozedur. Diesmal bin
ich richtig genervt. Die Jungs haben hier augenscheinlich nix zu tun. Es gibt
zwischen den beiden Kontrollen für uns nicht den Hauch einer Chance irgendwas zu
schmuggeln. Die machen sich nur wichtig, weil sie eine Uniform tragen wobei
einige sogar Zivilklamotten tragen. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich noch die Erfahrung
machen, dass man hier den meisten Menschen trauen kann - außer sie tragen eine
Uniform.
Guinea-Bissau
erscheint von Anfang an anders als der Senegal. Es liegt weniger
Müll rum, was auch bedeuten kann, dass sie vielleicht noch nicht so viele von
den berühmten Plastiktüten haben, die seit Marokko in fast ganz Afrika herumliegen. Jens erzählte mir die Geschichte, dass
es oft üblich ist, Orangenschalen fein
säuberlich in eine Plastiktüte zu stopfen, ehe man sie aus dem Fenster schmeißt.
Als
nächstes fällt auf, dass man hier offenbar auch nicht das nervtötende
"toubab, toubab" kennt. Es kann also ganz nett hier werden. Und schließlich
riecht es hier anders. Jedes mal, wenn wir durch ein Dorf fahren oder auch
später in der Stadt, riecht es anders als im Senegal. Hier wird zwar auch der
Müll verbrannt, wo er gerade hinfällt, aber hier mischt sich etwas schweres
hinein, das auf nicht unangenehme Weise riecht wie Mottenkugeln.
Und
dann gibt es nur wenige Moscheen mit ihren Muezzinen, weil dieses Land erst so nach und nach durch
Zuwanderer aus dem Senegal muslimisch wird. Mir stehen also nach dem Krach in
Zuiginchor, angenehme Tage
bevor.

Die
Straßen sind ganz gut. Es gibt auch mal ein paar ausgebesserte Stücke, die aber gut
befahrbar sind. Landschaftlich ähnelt es sehr der fruchtbaren Casamance im
Senegal, mit seinen Mangrovensümpfen und Reisfeldern. Nur ist es dünner
besiedelt. An Plätzen, wo Durchfahrende halten, tauchen wieder die üblichen
wilden Müllkippen mit ihren Plastiktüten auf.
In
São Vicente, dies soll ein richtiger Ort sein, ist aber nur eine
Aneinanderreihung von einem Dutzend kleiner Hütten und Restos für Geschäfte mit Durchreisenden,
kreuzt die Straße den Rio Cacheu. Gegenüber wartet die Fähre. Leider hat sie
Pause und fährt erst in 1,5 Stunden. So richtet man sich ein und versucht die
Zeit in einer der Hütten, die seeeehr flach sind, sagt mein Kopf, totzuschlagen.
Jens bestellt einen Kakao. "Mit Butter oder Mayonnaise?" "Wie bitte?" Na ja, es
gibt halt immer etwas Brot zum Getränk dazu. Der Kakao besteht dafür hauptsächlich aus Zucker und kann
anschließend noch
beliebig nachgesüßt werden. Der erste und einzige Typ, der mich voll quatscht,
ist natürlich aus Gambia und war sogar schon in Deutschland (alles sssuper
dort) wo er schon mal in Hannover in Abschiebehaft saß, weil er seinen Pass
weggeschmissen hat - schön blöd.
Die
Fähre kommt gaaanz langsam rüber. Leider kann sie nur in einer Richtung fahren.
Also dreht sie im Fluss und die Autos müssen rückwärts von Bord, was sehr abenteuerlich aussieht.
Wir
schaffen es dann endlich rüber zu kommen und heizen weiter im Tiefflug durch die
Landschaft. Die Straßen werden kurzzeitig mal schlechter aber alles in allem
kommen wir gut voran - unser Fahrer kennt sich ganz gut aus. Ein ghanaischer
Mitreisender meint allerdings, wir fahren viel zu langsam - finde ich überhaupt nicht.

Es
ist schon nach 17.00 als wir die letzte Kontrolle vor Bissau passieren.
Natürlich sitzt auch hier wieder ein uniformierter Wichtigtuer und erzählt davon, das Berlin so
reich ist und dort das Geld auf der Straße liegt - er weiß das ganz genau -
bekommt trotzdem nichts -
bleibt aber trotzdem friedlich.
Wir fahren noch ein Stück weiter in die Hauptstadt. Am Rand der Hauptstrasse erinnern ausgebrannte und verrostete Panzerwracks an den letzten Militärputsch und der entsprechenden Intervention Senegals und Guineas im Jahre 1998.
In der Nähe vom Flughafen ist Schluss. Wir fahren mit dem Ghanaer und einem Nigerianer, die beide bei uns im Busch-Taxi saßen, ins Zentrum auf der Suche nach Hotels. Die Straße geht am Flughafen mit seinem teuren und hässlichen "Bissau-Hotel" vorbei, entlang der wichtigsten Einfallstraße, wo an der Peripherie, im Stadtteil Belem, tausende von Menschen auf den Beinen sind. Wir klappern mit unserem Taxi das eine oder andere Hotel ab. Es ist nicht einfach, der Standard ist schlecht und die Preise hoch. Mein Magen-Darm-System ist immer noch malade und ich würde mich gerne auskurieren. Deshalb möchte ich ein eigenes Klo mit Spülung. Ich mache die Erfahrung, dass es nicht beides zusammen gibt. Entweder geht der Wasserhahn - oder die Dusche - oder das Klo - oder die Spülung.

Bissau hat eine marode Wasser und Stromversorgung und niemand hat hier offenbar die Kraft und das Geld, daran etwas zu ändern. Die politische Kaste ist durch und durch korrupt und vergrault eventuelle Investoren. So sieht man öfter einen Minister vor einem Restaurant vorfahren, dort etwas essen um dann ohne zu bezahlen zu gehen. Anderenfalls könnte ihm auffallen, dass vielleicht die Deckenhöhe um 4mm zu niedrig ist und die Konzession entziehen.
"Sie haben zu überhaupt nichts die Macht, außer etwas zu
stoppen", sagen die Leute - und "sie sind deshalb so dick, weil sie Geld essen".
Der
Präsident, ein kleiner Despot, gehört einer Gruppe an, die zur Erkennung eine
knallrote Pudelmütze trägt. Das sieht beim Staatsgründer Amilcar Cabral noch
ganz gut, beim jetzigen Präsidenten aber einfach nur albern aus.
Nach langem hin und her und Verhandlungen (dank Jens) landen wir im "Aparthotel Jordani". Dies macht zwar einen äußerlich passablen Eindruck, funktionieren tut aber auch hier kaum etwas. Es ist höllisch laut, weil die nahe Straße stark befahren ist und vor meiner Tür das Personal des Restaurants "Monte Carlos" bis in die Nacht seinen Plausch hält. Hier schläft man wohl nie.
Die Air-Condition bläst einem, wenn sie dann mal funktioniert,
den Kopf weg und wenn sie aus ist, ist es unerträglich heiß. Ich beschließe, am
nächsten Morgen auszuziehen. Verstärkt wird mein Entschluss durch das plötzliche
Auftauchen eines Soldaten, der 5000 CFA zum Betanken seines Fahrzeugs verlangt.
Ansonsten würde er mal mein Gepäck genauer unter die Lupe nehmen. Für
Diskussionen ist hier kein Platz. Er lässt sich nicht abwimmeln und das
Hotelpersonal guckt einfach weg. Außerdem bin ich alleine mit ihm und hätte
niemanden, der bezeugen könnte, wenn er mir etwas wegnehmen würde. Ich bekomme
allerdings eine handgeschriebene Quittung - natürlich nur über 500 CFA! Er könnte sich eigentlich ja auch sein Gehalt bei der Pudelmützenmafia holen.
Traue also keinem Uniformierten.
Dafür
hat das Hotel ein klasse Restaurant mit leckerer portugiesischer Küche. So hat
wenigstens mein Gaumen seinen Spaß.
Ich
sehe mich also am nächsten Morgen nach Ersatz um und gucke mir die eine oder
andere Katastrophe zu überhöhten Preisen an, die alle in meinem Reiseführer
als richtig gut empfohlen werden. Diese Empfehlungen stammen wohl noch aus der
Zeit vor dem Putsch. Die Probleme sind aber überall gleich und zwar
egal welcher Nationalität die Betreiber sind. Ich entscheide mich für die
"Pensão Central", einem einstmals gediegenen Laden an einer der
"Prachtstraßen" Bissaus mit Terassengang vor den Zimmern und mit
Gemeinschaftsbad. Hier geht als einziges die Dusche - der Rest wird über einen
großen Bottich erledigt.
Die
Pensão wird von einer resoluten alten Dame namens Berta geführt, die am Eingang
ihres kleinen Restaurants im 1.Stock sitzt, die Pensão regiert und mit gütigem
Blick das Geld einkassiert (15000 CFA).
Das
Zimmer hat drei Betten und einen kleinen Ventilator. In ganz Bissau gibt es
aber keine zentrale Stromversorgung. Die meisten großen Häuser haben einen
eigenen Dieselgenerator, der in den Abendstunden von 19.00 bis 23.00 Uhr und Vormittags von 9.00 bis
14.00 Uhr Strom erzeugt. Damit man nachts das Klo findet, werden auf dem Flur
alle paar Meter Kerzen aufgestellt.
Zwischen
den Ventilatorperioden wird es sehr heiß und ich schwitze literweise. Die
Nächte werden hart und ich fühle mich gar nicht gesund. Meine Magen-Darm-Geschichte
wird auch nicht besser.

Es gibt hier ansonsten nicht viel zu tun. Die Stadt ist nicht besonders groß, zu sehen ist nicht viel und wenn doch, dann ist es ziemlich kaputt, was hier mit dem entsprechenden Fatalismus hingenommen wird. Das meiste Leben findet am Vormittag statt. Dann ist die Hölle los, der Markt platzt vor Menschen, alle machen ihre Geschäfte, man wird tatsächlich direkt angesprochen (idR von Schwarz-Tauschern, da die Bank hier in Bissau kein Geld hat). Mittags versinkt Bissau in eine seltsame Schläfrigkeit und ich mache Siesta bis der Strom wieder abgeschaltet wird und sich der Propeller nicht mehr dreht.
Der Rhythmus in dieser Stadt wird
immer langsamer. Mir fällt das anfangs ziemlich schwer und ich muss mich
wirklich daran gewöhnen.
Wenn ich also Vormittags durch die Straßen gehe, bin ich Mittags so fertig, dass ich fast zwei Stunden schlafe, um mich dann mühsam wieder in Gang zu bringen. Dann gehe ich ins Internet-Café, Post erledigen oder Zeitung lesen (hier arbeitet Fatima, die an der Dresdener TU studiert hat und gut und gern deutsch spricht) und dann in die "Gelateria Baiana", eines der wichtigsten Straßencafés am "Praca Che Guevara" um einen leckeren Galão zu trinken.
Den Che haben sie aber abmontiert, wie fast alle anderen Standbilder und durch eine Eisenstange ersetzt - der einzige der bleiben durfte, ist Amilcar Cabral, der Staatsgründer.
Hier trifft man sich, wird gesehen und sieht zu, wie Straßenhändler ihre Ware präsentieren. Es ist fast wie im Kaufhaus, man kann hier neben den üblichen Erdnüssen, Orangen und Bananen auch Kleidung und Haushaltwaren kaufen, während man sich die Schuhe putzen lässt - mehr oder weniger überzeugend vom Gelände geschickt durch das Cafépersonal. Man sieht auch die vorbeifahrenden schicken Autos, von denen viele den ebenso vielen UN- und auch privaten Hilfsorganisationen gehören, die hier tätig sind. Dicke, neue, teure Allradfahrzeuge mit allen Schikanen und fetten Kurzwellenantennen am Bug. Die haben wohl ganz gute Konditionen bei den Herstellern. Bei den anderen, privaten Fahrzeugen fragt man sich aber, wer hier überhaupt und womit so viel Geld verdienen kann (vielleicht mit der einen oder anderen Hilfsorganisation ?). So vergeht also die Zeit mit Sitzen, Trinken und Essen um bis vielleicht 20.00 oder 22.00 durchzuhalten. Im einen oder anderen Café läuft Musik - meistens eine fröhlichere Variante der Kapverden-Musik oder Angola-Rap.
Wieder in der Pensão hänge ich dann das Mosquitonetz wieder auf und
versuche zu schlafen. Man sollte nur darauf achten, dass man erst Abends mit
Alkoholgenuss beginnt (z.B. 18.00) um nicht vollends zu verbuschen bzw. zu
versauern.
Manche
Stunden des Tages verbringe ich damit, auf meinem Terrassenplatz in der 2.Etage
zu sitzen und zu ermitteln, wie viele Autos mit Anhängerkupplung herumfahren. Es
sind
ca. 90 %. Wenn ich vor der Gelateria sitze, ist das Verhältnis seltsamerweise
umgekehrt.
Donnerstag
Abend fahren wir, diesmal in Begleitung von Jens neuer Flamme Helena, die vorgibt 25
Jahre alt zu sein und meistens tödlich gelangweilt aus der Wäsche guckt, an die
Peripherie. An einer Häuserzeile steht "Acordo de Abuja", was
bedeutet, dass in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, ein Abkommen für Guinea-Bissau
ausgehandelt wurde und Nigeria die Häuser bezahlt hat. Zu kaufen gibt es
ausschließlich Alkohol mit einigen kleinen Fressständen davor an der Straße.
Wir treffen Olu aus Nigeria, der mit uns im Buschtaxi nach Guinea-Bissau
gekommen ist. Er winkte mir zu - ich
habe ihn erst gar nicht erkannt, weil für uns Europäer doch die meisten
Schwarzen gleich aussehen. Außerdem ist hier Eliza, der für eine nigerianische
Kirche tätig ist und Predigten im Radio hält. Olu leiht sich von mir noch 1000
CFA - ich weiß allerdings nicht mehr wofür.

Am
Freitag geht endlich die Fähre nach Bubaque, einer Insel im Bijagos-Archipel
vor der Küste Guinea-Bissaus.
Schon
am Tag zuvor versuche ich meinen Rucksack vernünftig zu packen, was mir nur
bedingt gelingt. Er ist und bleibt zu schwer. Nun schleppe ich mich also damit
ab - zum Hafen ist es zum Glück nicht weit. Jens kommt, mit seiner Helena im
Schlepptau, im letzten Augenblick, bis pünktlich um 10.00 Uhr die
Passagierliste geschlossen wird. Jetzt geht es auf die Hafenmole, wo bereits
etliche Menschen mit Sack und Pack geduldig in der prallen Sonne warten. Hier
liegen viele mehr oder weniger seetüchtige Schiffe, oder was man dafür halten
soll - manche sind bereits im Hafen gesunken. Jedes mal, wenn durch Wellen einer
dieser Seelenverkäufer leicht gegen die Mole dengelt, wackelt die ganze
Betonmole. Von unserem Schiff, der "Venezuela", einem kleinen
Küstenkreuzer ist lediglich der Bug zu sehen, es liegt versteckt hinter
diversen Schleppern und Fischtrawlern, sieht aber ganz passabel aus. Der
Eigner, ein Portugiese, hat sein Schiff eigenhändig vom Mittelmeer
heruntergeschippert. Gegen 11.00 wird das Schiff an eine andere Stelle verholt.
Alle Passagiere schnappen sich ihre Fracht und laufen hinterher. Jetzt wird es
mal getankt, die Ladung und das Gepäck eingeladen und anschließend
eingestiegen. Irgendwie finden alle ihren Platz und nach einer weiteren Stunde
legen wir endlich ab. Das ganze hat nur deshalb so lange gedauert, weil
irgendein Minister sich nicht entscheiden konnte, ob er nun mit will oder
nicht. So lange wird eben alles gestoppt.
Wir
tuckern gemütlich, vier Stunden in der prallen Sonne (nächstes mal sitz ich
drinnen) nach Bubaque. Die Fahrt verläuft recht ereignislos. Ich komme ins
Gespräch mit Nicolas, einem arbeitslosen Franzosen, der die Zeit des Müßiggangs
mit Reisen nutzt und sich monatlich per Internet beim Amt meldet; mit Paul, einem
Australier, der seit 1999 mit dem Fahrrad unterwegs ist und Alain, einem
Physiklehrer aus La Reunion im indischen Ozean, der hier nicht nur portugiesisch
lernen, sondern auch möglichst viele Mädels flachlegen will.

In
Bubaque, dem gleichnamigen Hafen zur Insel, angekommen, legen wir erstmal an
der viel zu großen und zu hohen Hafenmole an und klettern mühsam an Land. Da
ich diesen sauschweren Rucksack auf dem Rücken trage, hat es auch etwas mit
Akrobatik zu tun. Ich muss mich auf die Bordkante stellen und mich gegen eine
Metallleiter an der Hafenmole fallen lassen, während sich das Schiff wieder etwas von
der Mole fortbewegt. Zum Spagat kommt es zum Glück nicht. Hilfreiche Hände
zerren mich rauf.
Bubaque ist ein kleiner Ort mit kleinem Fischereihafen und kleinen Bratküchen, einer Disco und einen kleinen Anzahl von Hotels und Campments. Die Wege dahin sind allerdings etwas beschwerlich; die Straßen sehen aus, als ob gerade am Ende der Regenzeit die Wassermassen durch den Ort gestürzt sind.
Die anderen Suchen
etwas billiges - ich suche etwas Komfort. Jens hat eine Hütte über eine
Bekannte in Bissau gemietet (noch billiger) - hier wohnt er mit seiner Helena.
Das
Hotel Canoa, das erste was ich besichtige, wird von Dora, einer Portugiesin
geleitet. Es ist auch sofort meine Wahl. Eine Hütte in einer schönen Anlage,
sauber und voll funktionsfähig für 10.000 CFA.
Den restlichen Nachmittag besichtige ich den Ort, suche die anderen in deren Campment auf und gehe mit Alain ein Restaurant suchen. Es gibt ein paar, nicht alle haben genug zu essen da - es ist keine Saison und es wird nur soviel gekocht, wie vorher bestellt wird, eine hier übliche Methode. Wir finden schließlich direkt am Hafen ein Resto mit Ghetto-Blaster und mit akzeptablen Preisen. Hier werden wir wohl noch öfter auftauchen. Wir holen noch Paul und Nicolas und gehen Bier trinken, draußen vor einer Kneipe am Hafen und anschließend in die Disco.
Guinea-Bissau hat, wie
andere Länder Afrikas auch, ein großes AIDS-Problem - hier und in den frankophonen
Ländern heißt es SIDA - und deshalb ist fast jede Kneipe mit kleinen Fähnchen,
mit einem schwarzen Panther drauf, geschmückt. Hier war der Kondomhersteller
"Panté" auf Werbetour. Das ganze Land kennt die Marke. Hoffentlich
wird sie auch benutzt.
Der
Abend ist sehr nett und die Nacht in meinem Zimmer sehr angenehm. Ich habe
lange nicht so gut geschlafen, es ist ruhig und kühl. Ich werde wohl eine ganze
Woche hier bleiben.
 Es
ist Sonnabend. Den Morgen beginne ich gegen 9.00 Uhr, setze mich dann in den
Schatten und beschäftige mich mit meinem Reisebericht. Gegen frühen Nachmittag
mache ich mich auf die Suche nach dem Strand. Es ist anders als in Europa. Hier
sind nicht die schönsten Strände, wo die Menschen sind. Es gibt auch keine
Promenaden und wenn, dann wären sie längst im Meer versunken. Es gibt zwar
einen kleinen Strand am Hafen, aber der ist nur bei Ebbe benutzbar. Man muss
etwas aus dem Ort raus, auf die nördliche Inselseite. Der Weg führt durch das
originale, koloniale Ortszentrum, was auf einer Anhöhe liegt (wo auch sonst).
Hier verrotten, teilweise unbewohnte Kolonialstilhäuser vor sich hin. Leben
findet hier kaum noch statt - außer im verbliebenen Postamt. Straßen und Plätze
sind kaum noch zu erkennen, weil sich die Wege überall hin ausgebreitet haben.
Wenn zum Beispiel in Afrika eine Piste Probleme, wie Löcher, aufweist, fährt
man einfach drum herum oder daran vorbei und die Straße wird immer breiter.
Trotzdem bekommt man eine Ahnung von dem was hier einmal los gewesen sein muss.
Es
ist Sonnabend. Den Morgen beginne ich gegen 9.00 Uhr, setze mich dann in den
Schatten und beschäftige mich mit meinem Reisebericht. Gegen frühen Nachmittag
mache ich mich auf die Suche nach dem Strand. Es ist anders als in Europa. Hier
sind nicht die schönsten Strände, wo die Menschen sind. Es gibt auch keine
Promenaden und wenn, dann wären sie längst im Meer versunken. Es gibt zwar
einen kleinen Strand am Hafen, aber der ist nur bei Ebbe benutzbar. Man muss
etwas aus dem Ort raus, auf die nördliche Inselseite. Der Weg führt durch das
originale, koloniale Ortszentrum, was auf einer Anhöhe liegt (wo auch sonst).
Hier verrotten, teilweise unbewohnte Kolonialstilhäuser vor sich hin. Leben
findet hier kaum noch statt - außer im verbliebenen Postamt. Straßen und Plätze
sind kaum noch zu erkennen, weil sich die Wege überall hin ausgebreitet haben.
Wenn zum Beispiel in Afrika eine Piste Probleme, wie Löcher, aufweist, fährt
man einfach drum herum oder daran vorbei und die Straße wird immer breiter.
Trotzdem bekommt man eine Ahnung von dem was hier einmal los gewesen sein muss.
Auf
dem weiteren Weg kommt man an kleinen, teuren modernen Hotels für hauptsächlich
Sportfischer vorbei und steht dann plötzlich mitten in der verlassenen Anlage
des Bijagos-Hotel, einer ehemals richtigen kleinen Stadt mit Bungalows, Restaurants und
kleinen Geschäften. Etwas dahinter hat man sogar einen Weg zu einer Landepiste
(mit eigenem schattigem Wartehäuschen) erweitert. Hier war man früher wohl
völlig autark und brauchte keinen Kontakt mit Einheimischen zu befürchten.
Jetzt ist die Anlage verlassen - eine Geisterstadt - und verfällt. Irgendwo
klappern Fensterläden und der Hotelbus rostet am Straßenrand vor sich hin, so
als wartet er auf Passagiere, die niemals mehr kommen.
Diese
Hotelanlage war noch bis vor 5 Jahren voll in Betrieb und wurde beim Abzug der
senegalesischen Besatzungstruppen von selbigen regelrecht zerlegt.

Gleich
darauf ist eine kleine Bucht mit einem kleinen Strand. Das Wasser ist nicht nur
bei Ebbe flach und piwarm. Einige Leute machen hier im Schatten Siesta. Der
Strand wird durch die Ebbe immer breiter und viele kleine Krebse in
unterschiedlichen Größen wuseln herum. Eine Rinderherde kühlt sich im nassen
Sand ab. Zwei junge Mädchen, durch "Vinho de Palmo", Palmwein,
angeschickert, setzen sich zu mir und albern rum. Sie haben mich gestern in der
Disko gesehen und sich sogar gemerkt, wie ich tanze. Eine Konversation kommt
aber nicht zustande. Ich will ohnehin weiter und verlasse die Szene in Richtung
Landepiste.
Der
Weg zweigt ab in die Pampa. An einer Abzweigung frage ich einen Jungen, wohin
es hier geht - es geht zum Friedhof. Er kann nicht so recht verstehen, was ich
dort will und hält mich womöglich für verrückt. Friedhöfe sind für mich
meistens ein interessantes Besichtigungsobjekt, da man daran etwas von der
Wertschätzung gegenüber den eigenen Leuten auch im Tode erkennen kann. Na ja,
aber so schön ist der Friedhof dann auch wirklich nicht.
Einen Bogen schlagend erreiche ich wieder Bubaque und lande im ehemaligen Zentrum. Ich höre zum ersten mal das Wort "branco", was "Weißer" bedeutet, aus Kindermund. Es ist aber noch bei weitem nicht so viel, wie das "Toubab" im Senegal oder in Gambia - zumindest kommt es mir noch so vor.
Abends esse ich "brochettes", (seeehr verkohlte) Fleischspieße
voller Knochen, am Hafen und beobachte die Szenerie. Einmal tragen einige Frauen
lautstark eine Auseinandersetzung aus - ein anderes mal balgt sich die Resto-Chefin, vor dessen Laden wir das gute Christal-Bier in uns reinschütten,
mit ihren 6 Kindern. Alle liegen wie ein Knäuel am Boden und lachen sich tot.
Anschließend legen sich die Kinder auf den Kühltruhen zum Schlafen. Es
ist recht angenehm, obwohl der nahe Brochettes-Stand uns voll räuchert. Hier
lässt es sich gut aushalten. Danach geht es wieder in die Disko. Heute
habe ich aber weniger Lust - die Musik gefällt mir auch nicht - hab’ ja keinen
zum Schmusen.
Der
Sonntag wird noch ruhiger. Mittags mache ich Siesta und gehe anschließend
Richtung Hafen. Man trifft sich hier und dort und schlägt die Zeit tot.
Der
Versuch ein Fahrrad zu leihen ist mir geglückt - es ist im Prinzip ganz
einfach. Man fragt einfach irgendjemanden und fast jeder, der ein Rad hat, ist bereit, es für
ca. 500 CFA die Stunde, herzugeben. Das
erste Fahrrad hat keine Bremsen, das zweite hat eher angedeutete
Bremsen und verliert alle 50m die Kette. Etwas genervt und mit schwarzen
Fingern gebe ich es zurück. Wenigstens hatten alle, die mich sahen ihren Spaß
daran, wie der blöde "branco" mit dem Ding zurechtkommt. Ich
versuche, das Thema auf den nächsten Tag zu legen und mir im Campment von Laurent,
einem der vielen hier lebenden Franzosen, etwas Richtiges zu leihen.
Ich
gehe noch etwas rum, mache Fotos. Der Mensch beim Postamt glaubt, ich hätte sein
kleines, hässliches Postamt fotografiert, was natürlich verboten ist und nervt
fürchterlich. Ich versuche ihn in allen mir geläufigen Gesten und Sprachen zu
beleidigen, aber er kapiert es nicht. Also lasse ich ihn einfach stehen.
In die Pensão Cruz Pontes würden Jens und ich, sollten wir doch noch länger bleiben, am nächsten Morgen umziehen. In seinem Haus ist es nicht so doll und mit seiner kleinen Helena hat er nur Stress. Sie denkt nämlich überhaupt nicht daran, dauernd zu Diensten zu sein und nebenbei noch für die Küche, inklusive Wasserschleppen, zu sorgen. Irgendwann holte sie sich wortlos die Schlüssel und zieht aus. Sie hat nämlich gestern Abend in der Disko einen netten Jungen kennen gelernt und Jens ist eifersüchtig.
Unter der Woche werden die meisten Hotels billiger. Wir
bestellen erstmal ein Abendessen - Fisch mit Maniok und Bananen. Was interessant
klingt, entpuppt sich als ein sehr enttäuschendes, trockenes, nur gekochtes
Essen. Danach gehe ich noch über den Hafen in mein Hotel zurück,
trink noch ein Christal und sehe etwas fern.
Es
wird doch langsam langweilig und Jens und ich beschließen, am nächsten Morgen
abzureisen.
Jens
meint, das Schiff geht erst gegen Mittag - also kann man ja beruhigt
ausschlafen. Als ich um 8.30 frühstücke, macht sich der Kapitän, der ebenfalls
hier wohnt, gerade auf den Weg zu seinem Schiff. Er legt pünktlich um 9.00 Uhr
ab. Dumm gelaufen - jetzt muss ich noch 6 weitere Tage ausharren.
Die
Hotelwirtin beruhigt mich aber, da noch eine Piroge am Mittwoch fährt.
So
habe ich wieder ausreichend Zeit, Berichte zu schreiben und etwas zu planen. Es
bringt mir wieder richtig Spaß, auf die Karten zu gucken und mir eine neue
Route auszudenken.
Im Campement von Laurent tauchen Nicolas und Paul wieder auf. Sie waren gestern Abend mit einem Motorboot auf die nahe Insel Soga gefahren, weil hier irgendeine Zeremonie (vielleicht ein Initiationsritual) stattfinden soll. Leider war dort überhaupt nichts los (vielleicht morgen, übermorgen oder überhaupt nicht) und dann fuhr das Boot noch nicht einmal zurück. Sie mussten dort im Freien übernachten und hoffen, dass am nächsten Morgen etwas fährt. Am Nachmittag haben sie dann eine Piroge genommen, auf der sie auch noch selbst rudern mussten. Das war ein Abenteuer. Die beiden sahen wirklich verhungert und reichlich verdurstet aus.
Wir fangen also schon Nachmittags mit dem Bier an und gehen
dann auf einen Snack und einem weiterem Bier an den Hafen. Abends essen wir
superlecker bei Dede einem weiteren Franzosen und seiner senegalesischen Frau
Kumba. Am Tisch sitzt dann noch einer - auch Franzose - der ohne Punkt und
Komma redet, nebenbei raucht, wie ein Schlot und dauernd husten muss. Sehr
appetitlich.

Am nächsten Tag starte ich Fahrradleihversuch Nr.2. Damit möchte ich mit Paul an das andere Ende der Insel zum Bruce Beach zu fahren. Das gemietete Fahrrad von Laurent ist klasse, der Trip macht Spaß. Paul ersteht unterwegs noch bei einem beinahe zahnlosen Mädchen namens Anita eine Flasche Palmwein und schafft es, sie fast ganz alleine auszusüffeln. Wir reden lange - Paul ist wohl einer der wenigen Australier, die ein richtig gutes Englisch sprechen.
Leider setze ich mich unglücklich auf meine Brille, die daraufhin in der Mitte durchbricht.
Der
Strand ist legendär, schön, einsam und wird nur von einem einzigen
Einheimischen genutzt. Er taucht laufend in der Szenerie auf, mal mit einem
Fischernetz, mal mit Palmnüssen, mal mit Palmwedeln. Er kommt scheinbar aus
allen Richtungen und hat überall seinen Kram verteilt. Baden kann man hier
auch. Während ich einfach so arglos reingehe, fallen Paul sofort einige Stachelrochen
auf, die mit ihrem Gift imstande sind, einen Menschen umzubringen - oops. Später wird mir noch
einmal von Einheimischen bestätigt, dass sie hier eine große, bekannte Gefahr
darstellen.
Abends
essen wir wieder bei Kumba und Dede - es gibt superleckeres Fischsteak.
Heute
ist Abfahrtstag. Nicolas, der noch für eine Nacht zu Jens ins Haus eingezogen
ist, kommt mit ihm um 7.30 Uhr vorbei, um mich abzuholen - sie wollen eine 8.00
Uhr-Piroge bekommen. Ich bin im Hotel als einziger wach und habe noch nicht
gefrühstückt und bezahlt. Also lasse ich sie ziehen, warte bis meine Leute aufwachen und stelle
mich auf eine 10.00 Uhr-Piroge ein. Erst fährt tagelang nix und nun diese
Auswahl.

Beim
Frühstück komme ich mit Anna aus Portugal ins Gespräch, die für eine NGO im
Archipel bilingualen Schulunterricht einführen soll. Sie erzählt mir so einiges
über die Insel. Es gibt hier ein großes Malariaproblem, an dem jedes Jahr viele
sterben, aber niemand dichtet die Fenster ab oder benutzt Mosquitonetze. Selbst
Dora, die es sich leisten könnte, hat lieber 1x im Jahr Malaria. Und bei
offenen Fenster ordentlich Licht an.
Anna
nimmt mich mit dem Organisations-Range-Rover zum Hafen zur Organisationspiroge, die ihr Laden zusammen mit der Mission Catolica betreibt.
Im Hafen liegen drei Pirogen. Eine große Piroge, mit der
Frauen der Insel den Fang nach Bissau bringen (auch ein NGO-Projekt), die
normale, öffentliche Piroge mit Jens und Nicolas und die Katholische mit mir. Wir
fahren kurz nach 10.OO Uhr ab. Erst kurz davor hat die Piroge mit Jens uns
Nicolas abgelegt. Man hatte wohl etwas Mühe zwei Rinder in die Piroge zu
wuchten. Wir überholen sie kurzerhand und sind in weniger als drei
Stunden in Bissau. Die Fahrt finde ich aber
nicht so ganz angenehm, weil die See sehr kabbelig ist, dauernd der Motor
stottert und wir Wasser nehmen, was eigentlich völlig normal ist, nur nicht
gerade vertrauenserweckend wirkt. Außerdem durchstechen wir so manches Wellental,
sodass alle recht nass werden. Trotzdem kommen wir in Rekordzeit in Bissau an.
Auf
der Piroge von Nicolas und Jens kam es sogar zeitweilig zum Totalausfall, weil
der Motor kaum lief und der Reservemotor gar nicht. Ohne Motor ist so ein
Schiff nur schwer beherrschbar. Als dann auch noch die dritte Piroge auf
offener See längsseits ging und die Leute planlos umstiegen, muss es wohl ganz
schön gefährlich ausgesehen haben. Das alles blieb mir erspart - trotzdem habe
ich erstmal genug - Wasser hat eben keine Balken.

Ich
buche mich wieder im "Jordani" zum selben Preise wie letztes mal ein
und
gehe noch ne Runde surfen. An der Straße gebe ich meine Armbanduhr zur
Reparatur. Die Batterien sind fast alle. Beinahe bereue ich es, als ich sehe,
wie dem Problem beigekommen wird. Es ist ein wahnsinniges Gefummel und mehr als
einmal habe ich die Uhr abgeschrieben.
Abends
gehe ich früh ins Bett. Ich habe irgendwie keine Lust auf jeden Abend Bier
reinschütten, bis in die Puppen.
Am
Donnerstag, endlich, geht es weiter. Jens holt sich noch schnell ein laissez
passage für Guinea in der Botschaft. An der garage trennen sich unsere Wege.
Ich setze mich in mein Taxi nach Bafatá und warte, bis es voll wird. Nach einer
Stunde wird der Wagen angeschoben - ab hier gibt es offenbar keine Anlasser
mehr - und es geht endlich los. Wir passieren die Kontrolle an der Stadtgrenze
- dort treffe ich Jens, der noch mal eine Zwangspause hat - und weiter geht es.
Unterwegs fällt ein paar mal die Benzinpumpe aus. Mit einem Stück Draht wird
das repariert. Während der ganzen Fahrt muss man darauf achten, dass einem keine
Ziege oder ein Rind vors Auto läuft. Die laufen nämlich überall frei rum, als
wenn sie keinem gehören. Man trifft sie auch dort, wo man niemals einen Menschen vermutet.

Die
Landschaft wechselt von weiten Reisflächen in ein Hügelland, von Flüssen
durchzogen, besonders vom Rio Gèba, an dem auch mein Ziel Bafatá liegt. Hier
wird der Reis, in einem gemeinsamen Projekt mit China, auch in Terrassen
angebaut.
Bafatá
erschließt sich einem erst, wenn man ein bestimmtes Hotel downtown sucht.

Ich
biege ab in Richtung Fluss. Die Häuser bekommen jetzt den alten Kolonialstil. Es
gibt eine Kirche, einen alten Palast, einige Verwaltungsgebäude, ein altes
Bekleidungsgeschäft oder ein altes portugiesisches Café. Alles mehr oder minder
verfallen oder kurz davor - aber mit Stil. Ziemlich weit unten, Richtung Fluss,
versuche ich das Maimuna-Hotel zu bekommen, was mir Paul empfohlen hatte. Es
ist belegt und ich nehme ein Zimmer im Aparthotel Terrango, gegenüber - noch
billiger. Es ist einfach, aber ausreichend. Im Maimuna trinke ich eine Coke und
versuche mit einem 500 CFA-Schein zu bezahlen, an dem eine Ecke fehlt. Das ist
mir mit meinem Portemonnaie passiert. Einige Male sind mir Geldscheine im
Reißverschluss hängen geblieben. Nun ist eine Ecke ab und keiner will den Schein
mehr haben. Zum Glück finde ich die Ecken, nur nix zum Kleben. Das Mädel vom
Hotel kommt also sofort hinterher, ich tausche den Schein natürlich um und
überlege, wem ich ihn als nächstes andrehen könnte.
Mit Dila, einem netten Angestellten des Hotels, der etwas französisch spricht, versuche ich einen Transport nach Gèba, einem verfallenen portugiesischen Handelsposten, etwas den Rio Gèba rauf, zu bekommen. Es ist schwer und wenn nur für viel Geld. Ich möchte lieber morgen Busch-Taxi-mäßig fahren - das ist billig und mit 500 CFA, angemessen. Ich zahle nicht 10.000 CFA ohne zu wissen, was und ob, etwas zu sehen ist. Ich lasse noch die alte Stadt auf mich wirken und überlege mir, was ich hier weiter tun könnte. Damit ich etwas zum Frühstück habe, gehe ich hinauf in das afrikanische Bafatá.

An der Garage treffe ich Nicolas, der eine kleine Odyssee
hinter sich hat. Er hat auch Interesse an Géba und sucht sich ein billigeres
Hotel, welches er auch findet, nachdem er einem Hotelier auf den Preis für
seinen Laden im Reiseführer aufmerksam gemacht hat. Wir gehen wieder downtown,
um den Sonnenuntergang über dem Rio Géba zu bewundern. In einer Badeanstalt,
die gerade Wasser für das Wochenende aus dem Fluss reinpumpt, haben wir einen
tollen Blick und etwas Bier. Wir gehen im stockdunkeln wieder rauf. In einem
Straßenresto essen wir etwas, bestellen aber viel zu viel. Wie es dann üblich
ist, geben wir den Rest den Armen, die alles ratzfatz aufessen. Beim Bezahlen
vermisst Nicolas seinen Geldbeutel. Er bekommt schlechte Laune. Er ärgert
sich, weil er mühsam ein billiges Hotel gesucht hat um anschließend einen
höheren Betrag zu verlieren. Wir gehen den Weg zurück. Er meint, er hat sein
Geld verloren, nachdem ich irgendwann mitten auf die Straße gepinkelt und er später auf
seine Uhr gesehen hat. Mit meiner Taschenlampe scanne ich den Weg zurück ab -
er ist übrigens ganz schön lang - und finden tatsächlich den Beutel im
Dunkeln auf der Strasse. Ich habe den kleinen Lederbeutel erst für einen Kuhfladen gehalten. Andere
wohl auch. Es ist sogar noch alles Geld drin.
Morgen
wollen wir gleich los, um einen Transport nach Géba zu bekommen. Aber - keiner
fährt. Wenn, dann nur für 10.000 CFA. Es ist zum Auswachsen. Ein
Busch-Taxi-Fahrer will uns für 2.000 CFA fahren, wir steigen ein und an der
Tankstelle will er plötzlich 5.000 CFA pro Nase - Idiot. Nicolas nimmt wortlos
sein Geld zurück und wir steigen aus. Leider fällt mir nicht rechtzeitig ein,
was ich dem Blödmann an seinem Auto kaputtmachen kann. Wir gehen zurück und
nach einiger Zeit schnappen wir uns unser Gepäck und nehmen ein Busch-Taxi nach
Gabú.
Es
ist ein kleiner Bus, voll gestopft mit Menschen. Ich sitze in der hintersten
Reihe, reingequetscht zwischen zwei Mamas. Ich werde solche Plätze noch zu
schätzen wissen. Es geht zumindest schnell und Gabú ist fix erreicht.
Ursprünglich
hatte ich ja eine Nacht hier eingeplant. Es ist aber noch früh und Nicolas will
weiter. Zu sehen gibt es hier auch nix. Nach einem schnellen Essen am Busbahnhof
bekommen wir noch zwei Plätze auf einem Bus zur Grenze.
Es
ist eng, zugig und das Gepäck eher lustlos auf das Dach gebunden. Wir verlieren
es auch fast, weil die Strasse eine schlimme Piste ist und wir ordentlich
durchgeschüttelt werden. Zum Glück sehe ich rechtzeitig einen Tragegurt von
Nicolas Rucksack vorm Fenster baumeln. Leider habe ich dem Fahrer vorher das
Geld - leider nicht passend und daher zuviel - gegeben. Während der Fahrt wird
das Fahrgeld eingesammelt - ich hoffe jetzt mein Wechselgeld wieder bekommen.
Jetzt stellt sich heraus, dass der Fahrer gar nicht daran denkt. Ich frage
andere Passagiere und es stellt sich heraus, dass der Fahrer innerhalb einer
Tour - natürlich nur für einige Passagiere - die Preise erhöht hat. Große
Aufregung, alle reden laut durcheinander und auf den Fahrer ein. Solche Späße
werden hier von niemandem geduldet. An der Grenze geht es weiter und während
ich die Szene eher amüsiert beobachte, regt sich Nicolas so richtig auf und
schafft es alles restliche Geld zu erkämpfen. Klasse.
Beim
Zoll, oder was auch immer, müssen wir unser Gepäck vorzeigen und werden dann
leise zur Kasse gebeten. Na ja - 500 CFA sind nicht die Welt.
Jetzt müssen wir das Taxi wechseln. Wir sind in Guinea-(Conakry) und hier werden wir Zeuge eines Wunders. Wir wundern uns nämlich, mit wie viel Klebstoff, Spachtelmasse und Rost ein PKW mit 10 Personen zuzüglich Ladung (hier fahren mindestens 2 Personen mehr mit als in Guinea-Bissau) sich fortbewegen kann, nachdem er allein von einem halbwüchsigen Jungen angeschoben wurde. Ein weiteres Wunder, dass wir über eine schlimme Piste den Grenzposten von Guinea überhaupt erreichen.
Hier
müssen wir die Pässe zeigen und anschließend auf die andere
"Straßen"-Seite zum "Zoll". Sah der Passkontrolleur von eben
noch halbwegs ordentlich aus, so ist der hiesige Zöllner ein Jungspund mit Muskelshirt,
der aussieht, als wäre er gerade aus der Disko geflogen. Er fragt uns, wie viel
Devisen wir einführen. Nicolas meint 40.000 CFA und ich meine, soll ja niemand
glauben, dass ich mir Guinea nicht leisten kann, 100.000 CFA. Der Jungspund
schreibt auf einen weißen, leeren Zettel unsere Namen und die Zahlen und
behauptet, es gäbe ein Gesetz, welches besagt, dass bei Einfuhr ab 100.000 CFA
eine Steuer von 10% fällig ist. "Wie bitte?" - Ich glaube ich höre
nicht recht. Jetzt bin ich so richtig geplatzt und habe den Spinner angebrüllt,
dass er diese Steuer gerade erfunden hat, dass er lügt, dass es ihm wohl Spaß
macht Leute zu schröpfen - soll er doch arbeiten gehen und, dass ich nicht
bereit bin, seine Parties zu finanzieren.
Non, non, non.
Darauf kommt er auf die
amtliche Tour und will mein Gepäck sehen. Wenn er Krieg will, dann kann er ihn
haben und ich zeige ihm Unterhose für Unterhose bis er selbst merkt, wie blöd
das ist. Das Geld will er aber immer noch. Ich werfe ihm 10.000 CFA verächtlich
und hasserfüllt vor seiner Nase auf den Tisch. Auf die Art will er das Geld nun
aber auch nicht und er weiß gar nicht, warum ich mich so aufrege, er befolgt
doch nur ein Gesetz. Jetzt gebe ich Nicolas vor den Augen des
"Zöllners" 30.000 CFA, so dass wir beide 70.000 CFA haben. Wat nu?
Jetzt ist doch wohl keine Steuer mehr fällig. Der Idiot besteht trotzdem
darauf, weil er die Zahlen doch auf seinen formlosen Zettel gekritzelt hat und
meint ihn nicht mehr ändern zu können. Er versucht das noch irgendwie zu
erklären aber jetzt brüll ich ihn nieder und lass ihn nicht mehr zu Wort kommen.
Wieder und wieder frage ich ihn, worin er jetzt ein Problem sieht und ob ich
sein Gekritzel etwa selbst ändern soll. Er gibt schließlich auf, blickt hilflos
zu Nicolas und ich gehe zufrieden zu unserem Taxi. Es ist immer wieder schön,
so einen Idioten zusammenzuscheißen.
Die
Ruckelfahrt geht weiter, bis wir den Flecken Saréboido erreichen. Hier werden
alle ausgeladen und hier wechseln wir Geld etwas abseits am Straßenrand. Dies
geht nicht nur recht reibungslos - es ist einfach die einzige Möglichkeit.
Ein
amtlich, seriöser Mann, so richtig ernst mit Brille, läuft hier herum, kritzelt
Zahlen auf irgendwelche Papierfetzen, die er dann verteilt, und addiert
Phantasiezahlenkolonnen an Häuserwänden. Es ist der Dorfverrückte, den alle
gewähren lassen. Alle bedanken sich auch artig für die gekritzelte Zahl auf dem
Fetzen Papier und schmeißen ihn weg.
Es
ist schon spät und es fährt nur noch ein Taxi weiter nach Koundâra, der nächst
größeren Stadt, wo auch die Autos aus dem Senegal entlangkommen. Irgendwie
glaubt der Fahrer, 8 Leute in seinen kleinen Peugeot zu bekommen (in den Kombi
gehen gerade 10). Das kann nicht funktionieren. So werden unsere Rucksäcke
kurzerhand wieder abgeladen und das Taxi fährt ohne uns ab.
Nun
stehen wir da wie blöd. Nicolas, der die ganze Szene verpasst hat, weil er sehr
lange auf dem Klo saß, fühlt sich verantwortlich und findet zwei
freundliche Leute in einem heilen Privat-PickUp, mit viel Platz und für den
gleichen Preis. Die Fahrt ist saubequem und geht über schlimme Piste bis nach
Koundâra, was wir noch vor der Dunkelheit inklusive einem schönen
Sonnenuntergang - durch die Wolkenbildung hat die Sonne schicke Querstreifen -
erreichen.

Wir
haben also die Strecke von Bafatá nach Koundâra in einem halben Tag geschafft -
das ist schnell. Wir finden schnell eine Unterkunft, das Hotel Nafaya. Ganz
schön heruntergekommen - ohne fließendes Wasser, aber mit Strom. Wir teilen uns
ein Zimmer und ein Bett für 10.000 FG (hier gilt der Franc Guinée), weil der
"patron" des Hotels uns sonst nur zwei Zimmer (eines für 5.000 und
eines für 10.000 FG) gegeben hätte, und bekommen kühles Bier. Da es mit dem
Essen Probleme gibt, lege ich mich mit dem Koch an - bin heute wohl irgendwie
auf Krawall gebürstet - Nicolas kann aber, da er Franzose ist, vermitteln, und
ich entschuldige mich ausdrücklich - Missverständnis.
So
trinken wir noch friedlich Bier und versuchen in dem stickigen Zimmer zu
pennen.
Im
Hotel ist noch länger etwas los - es ist nämlich ein Puff.
Wir
frühstücken morgens eine Cola auf nüchternem Magen und erreichen frühzeitig den
"Gare Routière", den Busbahnhof. Ein Buschtaxi ist schnell gefunden,
wir treffen auch Reisende von gestern wieder. Das Taxi, ein Peugeot 504-Kombi
wird mit 10 Erwachsenen und 4 Kindern überfüllt - die spinnen hier völlig. Dazu
muss man erwähnen, das ein hiesiges Auto mal gerade die Primärfunktionen
erfüllt. Das bedeutet, es hat vier Räder, die meistens gleichzeitig den Boden
berühren und mit der Mindestanzahl Schrauben befestigt sind, einen Motor, der
es meistens antreibt, bei Fahrten bergab aber oftmals abgestellt wird, ein
leidlich funktionierendes Lenkrad und etwas Bremsen. Die Türen lassen sich zum
Beispiel überhaupt nur von außen öffnen. Auf die mittlere Sitzbank passen 4
Leute und ich habe gerade einen viertel Platz und leide. Gelegentlich sitzen
vorne ebenfalls 4 Leute und auch schon einmal ein paar auf dem Dach.
Nächstes
mal kaufe ich zwei Plätze im Auto. Unsere Tour dauert über 8 Stunden und geht über
300km. Bei einer Pause taucht ein Schild auf: Labé 159km - na klasse, nur noch
2-3 Stunden in dieser Sardinenbüchse. Hier kaufe ich dann Beignets, kleine
runde Pfannkuchen. Da ich die Währung "Franc Guinée" noch nicht drauf
habe (1000FG=0,5€) werde ich missverstanden und bekomme eine ganze Tüte voll.
Ich versorge damit unser ganzes Auto. Daraufhin kotzt sich eines der Kinder
voll.
Als
wir nach 3 Stunden noch immer nicht angekommen sind, heißt es: Noch ca. 120km.
Wie das? Eine Mitreisender meint dazu, auf dem Schild war wohl Luftlinie gemeint
und auf dieser Piste mit seinen Kurven ist es doppelt so lang.
Dazu
dann noch die dauernden Passkontrollen. Hier zeigt sich, dass Armee und Polizei
auf Uniformspenden der ganzen Welt
angewiesen ist, weil es keine eigenen gibt. So wird man optisch von
amerikanischen und russischen Soldaten mit französischen und deutschen Mützen
angehalten. Natürlich ist die US-Army besonders beliebt. Das passt so gut zur
Sonnenbrille - sieht tierisch cool aus.
Ansonsten
ist das Ausweisspielchen sehr beliebt obwohl es völlig sinnlos ist. Die Leute
können nämlich oft gar nicht lesen und malen einfach die Zeichen ab. Schon oft
stand bei mir als Name "deutsch".
Die
Fahrt ist sehr anstrengend, obwohl die Landschaft sehenswert ist mit seinen
Tafelbergen, Hochplateaus, Savannen und üppigen Wäldern. Die Termitenhügel
sehen hier aus wie Pilze und sehen damit besonders lustig aus. Hügel mit Deckel
- und davon tausende - als ob hier mutierte Maulwürfe am Werk waren.
Wir
durchqueren das Gebiet der Peul, die eine eigene Architektur und Kultur haben.
Alles ist eingezäunt, kein Müll liegt herum, die Menschen wirken wohlhabend und
die kultivierte Landschaft wirkt großzügig und sauber. Später lerne ich darüber
aber, dass die Peul-Gegend durch Erosion als Folge von planlosem Holzeinschlag
sehr kahl und fast eine Wüste ist. Die wenige brauchbare Erde wird vom Regen in
die Täler gespült und damit man sie überhaupt nutzen kann, machen die Peul
lieber Zäune rum und hindern ihre Ziegen und Rinder daran, die wenigen Pflanzen
zu fressen. Zusätzlich bekommen die Tiere Querstangen um den Hals, damit sie
nirgendwo durchschlüpfen können. Jenseits der Umzäunungen wächst dann in Hülle
von Fülle trockenes, gelbes und nutzloses Gras.
Abends
kommen wir völlig verstaubt und verdreckt in Labé an. Wir haben das "Fouta
Djalon Plateau", eine bedeutende Hochlandschft (ab 1000m) erreicht.
Die
Stadt ist nicht die schönste, ist aber groß und hat Hotels. Ich brauche
dringend mal wieder etwas Komfort. Nicolas entscheidet sich spontan für die
Weiterfahrt nach Pita, da er nicht so viel Zeit in Guinea verbringen will.
Mit
einem Taxi suche ich das Hôtel Tata auf, wo es gute Pizza gibt und das wohl
viel von Angehörigen diverser Hilfsorganisationen und dem amerikanischen
Peace-Korps frequentiert wird. Ich bekomme ein Zimmer in einem Appartement, dass
ich für mich alleine habe. Da ich inklusive aller Ausrüstung die rötliche Farbe
der Straße angenommen habe, die nach zwei Tagen ohne Dusche recht fest geworden
ist, kann ich jetzt endlich ausgedehnt duschen und die dreckige Kleidung
waschen lassen.
Abends
gibt es Pizza, zwei Bier und ich falle erschöpft ins Bett. Die Nacht ist klasse
- ein paar Mücken fliegen im Zimmer,
nerven aber nicht groß rum.
Morgens
ist zwar das Wasser alle, aber das macht jetzt auch nichts. Wahrscheinlich
haben hier die Mädels der Peace-Corps-Truppe, die ebenfalls hier logiert, vor
ihrer Abreise geduscht.
Überhaupt
sind die meisten Gäste hier Mitarbeiter diverser Hilfsorganisationen. Ohne die
läuft hier wohl nichts. In fast jedem Dorf sieht man Schilder, auf denen auf
irgendeine Kooperation zwischen einem Land und Guinea hingewiesen wird. Man
sieht sehr viele Autos mit Aufschriften "GTZ", "USAID" oder
"UNHCR", letztere kümmern sich um die Flüchtlinge aus Liberia, Sierra
Leone und jetzt wohl auch "Côte d’Ivoire". Überhaupt gibt es wohl
zig-tausende Flüchtlinge in unzähligen Lagern in Guinea. Der Bürgerkrieg in
Liberia dauert immerhin schon 10 Jahre.
Beim
Frühstück treffe ich Thomas, der nicht nur für die GTZ, sondern auch in Hamburg
gelegentlich für meine Behörde arbeitet. Da sitze ich im tiefsten Guinea und
unterhalte mich über gemeinsame Kollegen und irgendwelche besonderen Seminare
in Hamburg. Meine "lieben Kollegen" werden sich jetzt schlapplachen.
Die
Welt ist also ein Dorf.
Ich
will noch in die Stadt. Labé ist wirklich nicht schön. Eigentlich ist es eine
typische afrikanische Kleinstadt mit den typischen Busbahnhöfen, kleinen
Garküchen und Obstständen, Werkstätten und Märkten nahebei. Ich suche
allerdings ein Internetcafé. Das ist nicht einfach, weil ich jedes mal in eine
andere Richtung geschickt werde, bis ich begreife, dass es drei Stück gibt und
jedes mal ein anderes gemeint ist. Leider hatten das erste und das dritte wegen
Sonntags geschlossen. Beim zweiten Laden sind die PC "en panne". Ich
erkläre mich im Laufe des Nachmittags bereit, eventuell bei der Reparatur zu
helfen, aber so etwas kann nur der "patron" entscheiden und der ist
auf einer Hochzeit und somit nicht da.
Im
Hôtel Tata wechsele ich das Zimmer, weil eines mit Mosquitonetz freigeworden
ist. Der Geschäftsführer zickt erst etwas - als ich ihm aber erzähle, dass ich
bei einem Internetcafé PC reparieren
will, ist er ganz von mir angetan und wäre am liebsten mitgekommen.
Abends
gesellt sich noch Ulrike aus Berlin zu Thomas und mir, wir klönen über dies und
das. Vieles verstehe ich gar nicht - sie sind Wissenschaftler und reden sehr
hochgestochen.
Diese
Nacht schlafe ich weniger schön.
Am
heutigen Montag versuche ich noch einmal ins Internet zu kommen, aber leider
kommen keine Verbindungen zustande. Auf dem gare routière nehme ich ein
Buschtaxi nach Pita. Der Fahrer fährt los -
ohne das obligatorische Tanken. Schön blöd - kurz vor dem Ziel geht ihm
der Sprit aus. Wir stehen in der prallen Sonne und sehen wie er per Auto-Stopp
mit einem kleinen Plastikbehälter im nächsten Ort Benzin holt. Auf
dem Rückweg sitzt er dann huckepack auf dem Kofferraum eines anderen PKW und hält
sich am Gepäckträger fest.
Als
wir in Pita ankommen, bin ich so genervt, dass dieser Ort, der so positiv im
Reiseführer beschrieben ist, bei mir keine Chance hat. Es ist ein typischer
kleiner Ort in Afrika und obwohl die
Gegend insgesamt recht fruchtbar ist, wirkt Pita ziemlich trocken. Die einzige
Sehenswürdigkeit, einem kleinen Wasserfall an einem chinesischen Staudamm,
kann so doll gar nicht sein.
Kurz
vor dem Busbahnhof gibt das Taxi ganz auf und ich kann den Rest des Weges mein
schweres Gepäck alleine schleppen. Danke und Tschüß.

Die
weitere Tour nach Dalaba ist angenehmer, das Taxi meistens nicht so
voll gestopft. Die Strecke geht durch Hügellandschaften mit Pinienwäldern. Es
sieht etwas europäisch aus - bis einen die nächste Palme daran erinnert, dass hier
Afrika ist.
Das
Hotel Tangama ist fix gefunden und mit 25.000 FG günstiger als das in Labé. Das
Nest ist aber ziemlich tot. Die Gegend lebt von einigen Natursehenswürdigkeiten
in der Nähe. Es scheint aber so, als ob keine Saison ist und ich hier der
einzige Tourist bin.
Ein
Ausflug in die Stadt ist nicht groß erwähnenswert. Das einzige, bedeutende
Gebäude ist die Moschee am Markt. Ich kaufe ein paar besonders leckere Beignets
und richte mich auf geruhsame Tage ein.
Abends
werde ich von einem Mitarbeiter des Tourismus-Büros im Hotel angesprochen. Das
Büro ist ganz in der Nähe. Er zeigt mir eine Broschüre mit allen wichtigen
Sehenswürdigkeiten der Gegend und davon gibt es tatsächlich einige.
Interessante Dörfer, Wasserfälle, Kiefernwälder, Gärten etc. Das klingt
natürlich wie eine super Touristengegend - erfordert aber fast immer ein Auto
und ist oftmals schwer zugänglich. Ich will die Broschüre - es gibt sie auch in
Englisch - kaufen. Sie ist so richtig "handmade" und soll 30.000 FG
kosten - non merci. Wir verabreden uns trotzdem für den nächsten Tag.
Abends
sitze ich noch im Hotel, im Garten. Es ist nett hier und schön kühl. Man muss
sich warm anziehen. Hier tummeln sich ein Kaninchen und ein Äffchen, diesmal an
einer losen Kette (später ganz ohne). Von Labé habe ich mir ein Buch
mitgebracht, dass dort ein GTZler liegen gelassen hat. Eines von denen, wo die
amis immer die Guten sind. Beim Lesen, besonders bei zunehmender Dunkelheit,
merke ich doch, wie mir meine zerbrochene Brille fehlt. Ich werde sie versuchen
zu reparieren, bzw. in gebrauchsfertigen Zustand zu versetzen. Gedacht, getan -
mit einer aufgebogenen Sicherheitsnadel und etwas Klebeband werden beide Teile
zusammengefügt und ich kann wieder scharf sehen. Es sieht zwar total krank aus
- irgendwie bescheuert - aber das Hotelpersonal gewöhnt sich schnell daran.
Das
Essen ist in diesem Hotel nicht so doll und vom hiesigen Skol-Bier bekomme ich
einen dicken Kopf.
Die
Nacht ist trotzdem klasse, mückenfrei und so richtig schön kühl.
Zum
Frühstück bekomme ich ein Omelette (superlecker). Der angekündigte, selbst gepresste
Orangensaft erreicht mich aber leider nicht. Es erscheint der nette Mann vom
Tourismus-Büro und erzählt etwas von einem Veló. Ich erinnere mich dunkel, dass
ich den Hotelmanager bat, sich um ein Fahrrad zu kümmern. Ich gehe also in sein
Büro und er erzählt mir, dass er zwar kein Fahrrad habe, aber dafür ein
Motorrad. Ich dachte zuerst, die wollen mich alleine mit dem Motorrad
loslassen, aber das war nie deren Absicht. Sie bieten Exkursionen an und fahren
selbst. Bei der Frage nach den Preise bekomme ich keine klare Antwort. Da ist
die Rede vom "guide" und von "essence" - aber keine Zahl.
Nach etwas Nachbohren erfahre ich 15.000 FG - geradezu billig. Ist das alles?
Ja, nein, "essence" - so heißt das Benzin hier - nochmal 15.000 FG.
Ist das alles? Inclusive? Na ja, sagen wir 35.000 FG. Wirklich alles? Es ist
wirklich schwer mit Afrikanern Geschäfte zu machen, sie sagen niemals einen
festen Preis und es kommt fast immer was dazu.

So finde ich mich also als Sozius auf einer kleinen Enduro-Maschine wieder - natürlich ohne irgendwelche Sicherheitskomponenten, wie Helm oder so. Vor mir sitzt Mamadou Diallo mit selbst gestrickten Fäustlingen an den Händen.
Der Vorname, sowie der Nachname sind wahrscheinlich die häufigsten in Afrika und begleiten mich seit Gambia bzw. Senegal. Ist halt alles eine große Familie.
Erst lassen wir kurz das "moto" checken, gehen noch zum Markt und
wechseln bei einem Bauunternehmer Geld - mit entsprechender Provision - und
brausen davon. Jetzt lösen wir das Problem mit der "essence".
Tankstellen mit Mopedsprit sehen anders aus, als bei uns. Es sind kleine Stände
an der Straße, wo in kleinen Regalen, mit Sprit gefüllte, Schnapsflaschen (eine
Rummarke heißt hier z.B. "Cap Ten") aufgereiht stehen. Ebenso gibt es
Öl in verschiedenen Qualitäten. Mir ist allerdings schleierhaft, wie der
"Tankwart" diese auseinander hält. Es steht nämlich immer noch
"Cap Ten" auf der Flasche.
Mamadou hat noch keine Ahnung, mit was für einen schlechten Sozius er zu tun hat, der bei jeder Kurve Schiss kriegt.
Das meiste der Strecke ist Piste, gut zu
befahren. Es geht vorbei an Kiefern(Pinien)-Wäldern, einem hier berühmten
Kräutergarten, sehen eine Herde Affen und nach etwa einer Dreiviertelstunde
erreichen wir Ditinn. Hier, irgendwo, sind die "Chutes de Ditinn", das
ist ein, zwar kleiner, Wasserfall, der aus 120m in die Tiefe stürzt. Das sieht
recht beeindruckend aus. Auch der Weg dahin ist recht interessant. Hinter jeder
Kurve hoffe ich, wir sind da. Jedenfalls ist das Ding ohne Führer nicht zu
finden. Kurz davor lassen wir das "moto" stehen und gehen zu Fuß
weiter. Ein "local", der zufällig des Weges vorbeikommt, soll auf die
Maschine aufpassen. Der Weg ist schön, verläuft in Flussnähe und ist
entsprechend grün. Der Wasserfall ist, wie gesagt, beeindruckend. Das Wasser
ist eiskalt, mir frieren fast die Zehen ab. Auf dem Rückweg will der
"local" plötzlich Geld, für 20min aufpassen, von mir 3.000 FG. Ich
gehe sofort in Touri-Abzocke-Abwehrstellung und verweigere die weitere
Geldabgabe. Erst einmal erkläre ich Mamadou die Bedeutung von Inklusiv-Paketen.
Der local ist sein Problem - mein Vertrag mit ihm war "inclusive".
Die Verlässlichkeit von Preisen ist noch ein großes Problem hier. Mamadou belässt
es dabei und gibt einen kleinen, angemesseneren, Betrag und wir sausen zurück.
Sein Trinkgeld bekommt er natürlich trotzdem. Er bittet mich noch, wenn ich
wieder zu Hause bin, einige Fotos und eventuell einen deutschen Bericht von der
Tour zu senden. Er möchte auch etwas für die deutschen Touristen parat haben -
mal sehen.

Das
Essen ist heute Abend etwas besser. Ich hätte natürlich auch in die Stadt gehen
können, aber dafür bin ich zu faul.
Nach
dem Frühstück, wieder ohne frisch gepressten Saft, sondiere ich noch mal kurz
die nähere Umgebung des Hotels. Alle Häuser liegen an schlechten Wegen, die
niemand repariert und haben eine Mauer drum herum. Außerhalb liegen verrostete
Baumaschinen und Reste von Baumaterial. Wenn ein Haus fertig ist, dann bleibt
alles liegen. Dazwischen sind immer wieder verfallene Reste von früheren Hotels
und anderen Gebäuden. Niemand räumt hier etwas weg. Alles außerhalb der eigenen
Umzäunung scheint hier niemanden zu interessieren.
Der
Hotelmanager kommt mit einen Jungen mit Fahrrad. Gerade jetzt habe ich mich
dazu entschlossen einen Wandertag zu machen und eventuell morgen abzureisen.
Pech gehabt. Der Junge kann mir wenigstens erklären, wie ich zu Fuß zur
"Pont de Dieu", der Brücke Gottes, komme, einer ausgewaschenen
Felsenbrücke, die sehr pittoresk sein soll.
Das
Ding ist sowieso nur zu Fuß zu erreichen. Mittags ziehe ich los. Jetzt ist
gerade die Schule vorbei und viele Kinder - es sind sehr viele - gehen heim.
Die meisten begrüßen mich mit "Bonjour, ca va?", dieser doch etwas
nervigen, französischen Höflichkeitsnummer. Drei kleine Mädchen machen zusätzlich
vor mir sogar nacheinander einen Knicks - jetzt übertreiben sie aber.
Dalaba
wird von einer Hauptroute mit entsprechend viel Verkehr durchschnitten.
Außerdem liegt es selbst sehr hügelig, so dass die Autos bergab mit Schwung und
lautem Hupen rein-, mittendrin rauf-
und am Ende in einer Linkskurve rallyemäßig raus fahren. Das alles in großer
Nähe zu kleinen Hütten und Häusern. Ein kleines Kind will zu seiner Mutter und
entgeht nur ganz knapp einem Unfall. Keiner passt darauf auf, das Leben spielt
sich an und auf der Straße ab und vielleicht sowieso gar keine Rolle.
Der
beschriebene Weg ist gut zu finden, weil ein Hinweisschild an der Straße die
Einfahrt markiert. Das ist schon einmal was. Mit Schildern ist das hier nämlich
so eine Sache. Sie weisen ungefähr in die Richtung, werden aber selten oder nie
bei z.B. Abzweigungen wiederholt. So ist man darauf angewiesen ständig zu
fragen. Hier ergibt sich das zweite Problem. Man bekommt immer eine Antwort -
auch wenn sie falsch ist. Manchmal bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich
richtig verstanden werde. Die Menschen sprechen hier nicht nur
"peul", die einheimische Sprache, sondern höchstens noch ein sehr
nuscheliges Französisch. So versuche ich also die Informationen für mich zu
filtern und aufzubereiten. Ich frage eine alte Frau, die mir entgegenkommt,
einen würdevollen Alten, einem modernen Teenager oder die hin- und wieder
auftauchenden, gnadenlos aufrecht gehenden Frauen, die die heutige Bananenernte
auf dem Kopf zum Markt tragen. Es mag recht klischeehaft
klingen, aber man begegnet hier sehr oft den aufrecht und hintereinander
gehenden, Lasten-auf-dem-Kopf-balancierenden Frauen. Das sieht sehr anmutig
aus. Zumal im ländlichen Bereich Guineas komischerweise die Männer sehr
westlich und die Frauen eher traditionell mit selbst genähten Kleidern und somit
sehr weiblich aussehen.

Ich
habe Glück und gehe intuitiv auf dem richtigen Weg. Da es sehr heiß ist, hoffe
ich hinter jeder Kurve mein Ziel zu sehen, aber dahinter ist immer wieder eine
neue Kurve und eine neue Abzweigung. Und zum Glück immer wieder jemanden zum
Fragen. Ich bin schon fast so weit umzukehren, als ich an einem versteckten
Peul-Dorf ankomme und ein paar Kinder mich zur "Pont de Dieu"
begleiten. Auch dieser Ort ist ohne Führung nicht zu finden.
Hier sitzen schon ein paar junge Männer, die Mädels trauen sich erst nicht weiter und schicken mich vor. Die Jungs haben zwar, wie so oft hier, nichts zu tun, lassen uns aber in Ruhe.
Die Felsenbrücke ist ganz nett, sieht
aber bestimmt nach der Regenzeit eindrucksvoller aus. Der Weg hierher hat sich
aber allemal gelohnt.
Ich
besorge mir noch in der Stadt einen Happen zu essen und erreiche, recht
geschafft, fast 1,5 Stunden später, mit hängender Zunge das Hotel.
Den
Nachmittag nutze ich dazu, meinen Rucksack drastisch abzuspecken. Nach Abzug
der Winter- und der Campingabteilung und einiges Extra-Schnickschnack gelingt
es mir mein Gepäck um ein drittel zu reduzieren. Suuuperleicht. So bringt das
Reisen doch richtig Spaß. Vielleicht werde ich das überflüssige Gepäck hier zwischenbunkern und eine Woche durch die Gegend reisen. Mal sehen.
Abends
mag ich gar nichts mehr essen. Da Bier - ich bin seit gestern beim heimischen
"Guilux" - schmeckt aber. Zu mir gesellt sich Xavier aus der
französischen Schweiz. Er sieht sich schon mehr deutsch reden müssend, was nicht seine Stärke ist, aber nix da, ich will französisch lernen. Wir
unterhalten uns prächtig über unsere bisherigen Erlebnisse und Pläne.
Am
nächsten Morgen, beim Frühstück, beschließen wir, ein paar Tage gemeinsam über
Sandpiste mit seinem Allradwagen zur Küste zu kommen. Diese Variante hatte ich
bis dahin noch gar nicht auf dem Zettel. Da er aber noch zwei Tage wegen
Krankheit pausieren will, werde ich dem Ort Pita noch eine Chance zu geben und
mich in zwei Tagen dort mit ihm treffen. Beim Frühstück sitzt außerdem noch Tim
aus England, mit dem ich bis Mittag noch klöne und den ich vielleicht noch in
Mali wiedertreffe.
Ich
checke aus und begebe mich zum Markt.
Hier entscheide ich mich, nicht direkt nach Pita, sondern entgegengesetzt nach
Mamou zu fahren. So bekomme ich auch dieses Stück dieser schönen Strecke zu
Sehen. Das Auto ist diesmal nicht so voll und erreicht nur für kurze Strecken
seine volle Kapazität. Die Strasse, bzw. die Landschaft ist wirklich sehr
schön. Immer wieder kann man weit in die Gegend blicken und verfolgen, wo an
den sanften Bergen die Strasse verläuft. Bei Gefälle schaltet der Fahrer den
Motor aus. Einmal wird das Gepäck nach oben verfrachtet und dafür in den
Heckraum drei Ziegen und ein paar Hühner gewuchtet. Geht alles.
Wir
erreichen Mamou am frühen Nachmittag, natürlich nicht ohne am Ortseingang die
Pässe, besonders meinen, zu kontrollieren.
Man
lässt mich am "gare routière" nach Conakry raus. Hier ist gleich eine
Polizeistation und will mich dort nach einem Internet-Café erkundigen. Der
Polizei-Chef, er
betont das richtig, ist trotzdem scharf auf meinen Pass. Einer seiner Untergebenen trägt
eine Trainingsjacke mit einem Bundeswehr-Aufnäher, so richtig mit Bundesadler.
Ich erkläre ihm, dass das "militaire allemand" bedeutet. "Was,
militaire allemand?" - Er rennt sofort zu seinem Kollegen und berichtet
stolz: "Weißt Du was das heißt? Militaire Allemand!". Der Mann ist so
glücklich, dass er mich direkt zum Internet-Café bringt. Leider ist das
Telefonsystem in Guinea ziemlich am Boden, es kann auch mit der Stromversorgung
zusammenhängen, so dass es keine Verbindung gibt. Schade, aber ich wollte
eigentlich nicht hier bleiben. So packe ich meinen, jetzt superleichten,
Rucksack und suche den "gare routière" auf. Ich muss nur dummerweise
zu dem für Labé, also am anderen Ende der Stadt. Nach ein paar
Kilometern finde ich ihn sogar und kaufe meinen Platz nach Pita. Ich frage nach dem
Preis: "6.500FG","Inklusive Gepäck?","Ja, ja ","Für beides?","Gepäck ist 2.000FG","Also
zusammen 8.500FG?","Nein 6.500FG","Also doch zusammen
6.500FG?","Ja ja".
Als
das Taxi endlich mit 11 Erwachsenen und 2 Kindern abfährt, will der Platzwart
noch 1.000FG für das Gepäck. Zusätzlich zu den Leuten im Innenraum nehmen wir
noch 2 Leute auf dem Dach mit. Wenn eine der üblichen Kontrollen kommt, steigen
sie schnell ab, gehen zu Fuß durch um danach schnell wieder, in Sichtweite,
wieder aufzuspringen. Der Fahrer fährt sehr schnell und einmal öffnet sich
sogar bei hoher Geschwindigkeit die Tür an der ich sitze. Da sie vorne zu viert
sitzen, muss er beim Schalten seinen Sitznachbar zwischen die Beine greifen. Die
gesamte vordere Innenverkleidung einschließlich Lenkrad und Armaturen - also
vom Blinkerhebel bis zum Handschuhfach - ist so locker, dass sie bei jedem Loch
droht herunterzufallen und wird wohl nur durch das Festhalten des Lenkrades auf
Höhe gehalten. Durch Dalaba heizt er mit höchstmöglichen Tempo durch. Leider
kann er sein Kommen nicht wie alle anderen ankündigen, weil seine Hupe nicht
funktioniert.
Als
wir Pita erreichen, bin ganz froh darüber. Beim Aussteigen frage ich nach einem
gutem Hotel. Sofort renntg einer los und bringt mehrere, zum Teil
alkoholisierte, Leute die mich zu einem Hotel führen wollen. Sie reden alle durcheinander bis ich "STOPP"
brülle. Ich lasse mir kurz den Weg beschreiben und gehe alleine los. Ich krieg
schon wieder einen Haß auf dieses Nest. Das Hotel Kinkon wird zwar großkotzig
angekündigt - auf den Plakaten steht was von "chambres, nightclub,
bar" - entpuppt sich aber, nach viel Fragerei, als ein schäbiges, kleines,
schmutziges Haus, welches nicht als Hotel zu erkennen ist. Hier findet man
keine Schilder, keine Hinweise, noch nicht mal am eigenen Haus. Es ist
wenigstens mit 10.000FG nicht teuer. Trotzdem bin ich frustriert. Mein Gepäck lasse
ich erstmal stehen und erkundige mich nach Alternativen. In der Nähe ist das
"Le Forèt de Sacrée", ein minikleiner Schuppen, ebenfalls mit
"bar und nightclub", mit 2 schäbigen, komfortlosen und fensterlosen
Zimmern neben einer Tanzfläche. Die sind hier echt nicht ganz dicht - nach dem
Preis frage ich gar nicht erst.
An
der Hauptstraße esse ich etwas in einem Straßenrestaurant.
"Restaurant" bedeutet hier, dass es einen kleinen Stand aus Holz und
Blech mit einwenig Kinderzimmergestühl gibt. Es gibt keine Speisekarte, sondern
sucht sich etwas an der Straße aus. Nur Morgens gibt es z.B. auch ein Omelette
- persönlich gebrutzelt von Chef. Heute Abend gibt es Kartoffelsalat mit Brot.
Ist nicht schlecht, vielleicht war die Köchin - hier kocht eine für alle dasselbe
- etwas zu großzügig mit der Mayonnaise. Viel Essensauswahl gibt es ohnehin
nicht. Entweder einen Kaffee (mit oder ohne Mayonnaise), Kartoffelsalat, Reis
mit oder ohne Suppe oder Brochettes, kleine schwarze Fleischspießchen.
Es
ist zwar schon etwas dunkel, doch ich will mir doch noch das dritte Hotel, die
"Auberge de Pita" anschauen. Sie liegt am anderen Ortsende, ich muss
also komplett durch, und ganz weit abseits - natürlich wieder ohne irgendwelche
Hinweise in eigener Sache - sehr schwer und nur zufällig zu finden. Der Preis
ist mit 15.000FG für ein Zimmer mit Klo und Dusche zwar angemessen, aber es ist
einfach zu weit. Meine morgiges Tagesziel, die "Chutes de Kinkon",
liegen an der Seite, wo ich jetzt wohne und nahebei will ich übermorgen Xavier
treffen.
Ich
bin also immer noch frustriert. Ich kehre zum "Kinkon" zurück. Auf
der Gemeinschaftstoilette stelle ich fest, dass ich Blut im Urin habe und es
beim Pinkeln brennt - "merde". Ich versuche dem Problem erst einmal
mit Antibiotika beizukommen, sehe mich aber in einigen Tagen in Conakry beim
Arzt. Jetzt bin ich besonders froh, bei Xavier angeheuert zu haben. Sehr
nachdenklich versuche ich zu schlafen, als auch hier in einem Nebengebäude der
"nightclub" loslegt. Es geht bis in den frühen Morgen - aber ich habe
Lärmstopp dabei. Außerdem bin sowieso dauernd wach, weil ich literweise Wasser
trinke.
Am
Morgen wird die Urinfarbe schon wieder besser. Ich verlasse zeitig das Haus und
gehe zu den Straßenrestaurants, frühstücken. Es gibt lecker Süßkakao und ein
Omelette. Die Zeit vertreibe ich mir mit der Lektüre der Beipackzettel meiner
Malaria-Pillen. Besonders "Paludrine" kann bei Überdosierung Blut im
Urin erzeugen. Falls mich das stört, kann ich ja ein Medikament dagegen nehmen -
die sind auch nicht ganz dicht. Ich beschließe die Prophylaxe-Dosen zu
halbieren, da ich vermute, dass meine Nieren ein Problem haben (zuwenig Wasser).
Ich werde jetzt sehr aufpassen, den Bierkonsum einstellen und das ganze bis
Conakry beobachten. Tatsächlich bleibt mir auch gar nichts anderes übrig.
Im
Polizei-Commissariat hole ich mir die Erlaubnis, die "chutes de
kinkon", jene berühmten Wasserfälle, zu besichtigen. Die Daten in meinem
Pass werden fein säuberlich in eine Liste und auf einen Eintrittszettel
übertragen. Ich heiße mal wieder "deutsch".
Es
sollen etwa 10km Weg sein. Nach einem guten Stück, die Hauptstraße nach Labé,
biege ich links ab. Jetzt folge ich der Straße nach Télimelé, die ich morgen
mit Xavier benutzen werde. Die Temperaturen sind noch angenehm kühl und die Landschaft
sehr schön. Ich habe weite Sicht in alle Richtungen. Irgendwann kommt ein
Abzweiger - mit Hinweisschild. Der Weg wird schlechter und schlechter und ich
frage mich immer wieder, ob ich hier noch richtig bin. Zum Glück tauchen immer
wieder Leute auf, die mir immer wieder den Weg bestätigen, bzw. sagen, welchen
Abzweiger ich wohin nehmen soll. So laufe und laufe ich weiter. Meine Füße
melden sich und wollen nicht mehr. Sind es wirklich nur 10km? Ich versuche auch
dies herauszufinden, aber die Entfernungen werden in Afrika wohl eher variabel
gehalten. Leicht genervt stapfe ich weiter, dauernd nach dem Weg und nach der
Entfernung fragend. Zu blöde, ich hatte Recht, als ich damals hier nicht
geblieben, sondern weitergefahren bin.
Nach langer Zeit taucht erst in der Ferne ein Stausee und dann ein gesichertes Gelände auf. Ich scheine da zu sein. Ein Wachtposten nimmt mir meinen Eintrittszettel ab. Vor mir liegt ein Trümmerfeld von Straßen und Häusern. Hier war wohl einmal mehr. Eine Kaserne, eine Hotelanlage, eine Fabrik, irgendwas. Es ist nichts mehr zu erkennen. Hier liegen nur Trümmer und Müll und einige Baracken von den Chinesen, die damals den Staudamm, der auch hier ist, gebaut haben. Sonst kaum ein Mensch. Selbst auf dem Gelände muss ich weiterfragen, wo die "chutes" sind. An einem Ende des Geländes ist dann eine ehemals richtige Straße zur erkennen, die zu den "chutes" führt. Ich folge ihr und treffe auf eine tiefe Schlucht, in der ein bißchen Wasser rauscht. Na klar, die "chutes" werden aus dem Stausee gespeist. Da der aber tagsüber gefüllt wird, damit die Gegend wenigstens nachts etwas Strom hat, sind die Schleusen zu. Dieser Damm versorgt die ganze Gegend von Labé bis Mamou. Der kleine Rest sieht aber wenigstens ein kleines Bisschen imposant aus. Man kann sogar zu den "chutes" (Fällen) runterklettern und in den Schlund fotografieren. Wenn jetzt einer die Schleuse öffnet, wird man gnadenlos runtergespült. Ein bisschen Schiss hab ich dann doch und klettere nach dem Foto schnell wieder rauf.
Der Rückweg ist sehr mühsam, meine Füße schmerzen und die eine oder andere Blase ist entstanden. Das mit den 10km kann nicht stimmen - gefühlt sind es dreißig. So schleiche ich langsam und fußkrank zurück, jeden Stein verfluchend. Die Rettung naht auf etwa halber Strecke in Person eines Jungen mit Namen Mamou mit seinem Moped. Er sieht mich, ich überlege nicht lange und schon sausen wir los. Nach kurzer Zeit bin ich im Hotel zurück, meine Wunden lecken.
Abends schaffe
ich es nur noch in Zeitlupe in den Ort zu schleichen, dort aber ein richtiges
Restaurant, "L’Amité", zu finden. Das Essen, ein gutes Steak, ist
lecker.
Nachts
läuft in meinem Hotel ziemlich laut ein Horrorfilm. Trotzdem schaffe ich es
recht lange zu schlafen. Morgens, nach dem Süßkakao-Omelette in meinem
Stamm-Frühstücksrestaurant, treffe ich Xavier, pünktlich an der verabredeten
Stelle. Wir folgen zuerst der Straße zu den "chutes". Danach ändern
wir die Richtung und fahren, auf breiter Piste weiter. Links und Rechts ist
weite Landschaft. Das gelbe Gras sieht aus wie wogende Weizenfelder, unterbrochen
von kleinen Wäldchen, Gebüschen und kleinen Flussläufen. Würde nicht hier und da
der eine oder andere Afrikaner in der Szene auftauchen, würde ich denken, ich
wäre in Europa. An Brücken findet man z.B. fast immer Frauen beim Waschen.

Die
Landschaft wechselt in eine Hochgebirgslandschaft. Die Straße windet sich etwas
an den Bergen entlang - immer schon die Straßenkurven des nächsten Berges in
Sichtweite. Es macht Spaß zu fahren und wir haben oft schöne Motive für Fotos.
Oft müssen wir den vielen Ziegen und Rindern ausweichen, die hier überall im
Weg rumlaufen. Hin und wieder sehen wir kleine Affen.
In
einiger Entfernung sind Berge mit Granitfelsen, dazwischen unwegsames Busch-
und Waldgebiet. Trotzdem taucht immer noch dazwischen das eine oder andere Dorf
auf. Für die Dörfer wurden wohl die Hinweisschilder von den Saudis spendiert.
Sie haben hier immer einen Zusatz in arabisch.
Oft
haben die Dörfer Rundhütten - oft aber auch Häuser in hiesiger Standardbauweise
mit kleiner Veranda. Die Veranda haben dann aber auch tatsächlich alle.
Mitten
auf der Strecke treffen wir einen Franzosen zu Fuß, mit Rucksack, den Xavier
bereits vor drei Monaten schon einmal getroffen hat. Die Welt ist klein. Die
Straße führt jetzt stetig abwärts und endet an einem Fluss. Wir fahren rauf, der
Fährmann wird gerufen und, nachdem auch noch ein Buschtaxi geentert hat, geht
es los. Die Fähre wird an einem Drahtseil per Handkurbel angetrieben. Drüben
angekommen, will er natürlich Geld. Er hält unseren 4x4 für einen LKW und will den
dreifachen Preis, den er dem völlig überladenen Buschtaxi hinter uns abknöpft.
10.000FG. Natürlich gehen wir beide in Touri-Abzocke-Abwehrstellung. Dumm, dass
wir vorne stehen, so blockieren wir die Fähre. Für die Hälfte fahren wir dann
weiter. Wir hätten ihn auch ärgern und so weiterfahren können.
Am
frühen Nachmittag erreichen wir Télimélé, eine kleine Stadt mit einigen Hotels,
darunter einem ganz neuen Hotel, wie mir Paul, der Australier erzählte. Wir
müssen uns entscheiden, ob wir hier nächtigen oder uns trauen, Richtung Boké,
weit an der Küste, weiterzufahren. Wir sind heute mal mutig und fahren weiter.
Am
Ortsausgang, an der üblichen Polizeikontrolle, knallt es plötzlich und etwas
schlägt gegen die Windschutzscheibe. An der Stelle ist jetzt ein sternförmiger
Sprung. Xavier meint, es wäre eine unreife Mangofrucht, ich glaube es ist etwas
anderes. Es gibt ja noch andere Früchte, die einen erschlagen können.
Jedenfalls meinen die Polizisten, die Straße noch Boké ist eine "bonne
route". Also los.

Die
Piste schlängelt sich weiter die Berge hoch und entsprechend schnell sausen wir
wieder hinab. Die Baumkronen treffen sich in der Straßenmitte und spenden
Schatten. Hier und da kommt ein Dorf. Uns fällt auf, dass die Leute doch recht
erstaunt gucken, als wir durchfahren - als ob wir Außerirdische wären. Die
Antwort ahnen wir, als der Zustand der Straße immer schlechter wird. Es werden
mehr Löcher, immer mehr Felsen, die nur mit Autos mit entsprechender
Radaufhängung überwindbar sind. Die Strasse kommt uns vor wie ein seit kurzem
trockenes Flussbett mit lauter grobem Geröll und steilen Ufern. Plötzlich,
nachdem wir ein Feld nicht unähnlich eines Lavafeldes ohne Wegmarkierung
durchholpert haben, stehen wir vor einem richtigen Fluss. Nachdem wir die Tiefe
gecheckt haben fahren wir mit richtiger Bugwelle durch, ein schmaler Weg führt
steil bergauf, über echte Felsen - wir werden durchgeschüttelt und das Auto
ächzt und stöhnt. Wenn nicht manchmal Reste einer alten Reifenspur zu sehen
wären, würden wir meinen, wir sind die ersten, die diesen Weg nehmen. Deswegen
gucken alle so komisch. Diese Strecke ist auf jeden Fall diesen Tag nicht mehr
zu schaffen - es wird gegen 19.00 dunkel.
Wir
lassen uns bis Sonnenuntergang weiterschütteln und stellen uns für die Nacht an
den "Straßenrand". Xavier kramt in seinem Material und findet noch
einen Kocher, etwas Nudeln und einige Dosen Ölsardinen aus Marokko. Außerdem
gibt es noch einen leckeren Rotwein. Wir klönen noch recht lange - mein
französisch wird immer besser. Ich quatsche ihn so richtig voll. Wir haben
beide schon einiges an Afrikaerfahrung und uns entsprechend viel zu erzählen.
Irgendwann taucht aus dem Nichts ein Einheimischer auf (bonsoir, ca va?). Man sieht ihn erst im letzten Augenblick. Genauso plötzlich verschwindet er auch wieder.
Xavier hat auf seinem 4x4 ein Dachzelt. Es ist sehr
breit und wir können uns gut arrangieren. Man schläft toll in so einem Ding,
wenn auch die Eingänge etwas ungünstig platziert sind.
Morgens
gibt es noch einen schnellen Kakao mit Butterkeksen.

Wir
schaukeln weiter. Eine Pavianherde kreuzt unseren Weg. Nach jeder Kurve hoffen
wir, dass die Straße besser wird und werden enttäuscht. "Bonne route".
Diese Bemerkung kommt sehr oft. Jedes mal, wenn wir denken, gleich bricht die
Achse oder gleich platzt ein Reifen. "Bonne route". Gelegentlich
kommt ein Dorf und ein Fluss und die Waschfrauen springen erstaunt zur Seite.
Danach wieder Felsen, die Allrad erfordern - "Bonne route". Einige
Male müssen wir wieder nach dem Weg fragen und verfahren uns - zum Glück nur
ein wenig. In einem Dorf liegen die sterblichen Überreste eines Autos. Das war
wohl das letzte Auto, welches diese Route versucht hat und kläglich gescheitert
ist.
Die
Leute hier staunen zwar über uns, die Männer laufen aber, wie schon zuvor
beschrieben, modern gekleidet rum, oft sogar mit einem Transistorradio in der
Hand. Die Kleidung, viele Werbe-T-Shirts aus Deutschland, kaufen sie aber in
den Boutiquen - so nennt man die kleinen Verkaufs-Bretterbuden - in den kleinen
Städten und Dörfern. Und diese Kleidung stammt fast ausnahmslos aus Altkleiderspenden.
Selbst die Stoffe, aus denen sich die Frauen hier ihre so traditionellen
Kleider nähen und deren Muster in ganz Westafrika gleich sind, stammen aus
England. Hier wird nichts im eigenen Land produziert. Selbst die Schuhe kommen
oft aus Nigeria.
Gegen Mittag erspähen wir in der Ferne eine Piste mit Autoverkehr. Hurra, wir haben es geschafft. Wir ruckeln Vorsichtig in ein Tal hinein, überqueren eine Brücke und schon haben wir die gute, alte Piste wieder - Lochfrei. Wir klettern eine Steigung hinauf und landen in einer Baustelle. Es sieht so aus, als wenn hier eine große Straße gebaut wird. Wir passieren einige Baufahrzeuge und folgen der Spur zur neuen Straße. Verwundert sehen wir die Breite. Soll das hier eine Autobahn werden?

Ungläubig folgen wir ein Stück. Wir können hier locker 100
Sachen fahren. Plötzlich taucht vor uns ein Lastwagen auf. Der ist so groß, dass er die Hälfte der
"Autobahn" ausfüllt. Nach kurzer Zeit ist der Spaß zu Ende. Einige Arbeiter
teilen uns mit, dass wir inmitten einer riesigen Mine rumfahren, wo wir nichts
zu suchen hätten. Sie zeigen uns den offiziellen Weg hinaus. Hierzu müssen wir
auf das Gelände der Minengesellschaft. Man teilt uns mit, dass hier eine
Bauxitmine ist, die von einer US-amerikanischen Gesellschaft mit kanadischen
Fachleuten ausgebeutet wird. Die Handarbeit dürfen die Einheimischen machen.
Die können sich irgendwie nicht vorstellen, wo wir herkommen. Anscheinend
benutzt tatsächlich niemand den Weg, den wir uns so mühsam ertrotzt haben. Wir
müssen uns am Haupttor melden. So durchqueren wir das Gelände, Xavier dreht aus
purer Neugier noch eine Ehrenrunde (wo wir schon mal da sind) und sehen die
Labors für die Geologen und andere Fachleute, eine moderne Krankenstation und
ebenso modernes Verwaltungsgebäude. Erst dann landen wir am Haupttor. Hier
erwartet man uns schon, seitdem wir die ersten Baufahrzeuge gesehen haben. Wir
müssen den Wagen an die Seite fahren, unsere Pässe präsentieren und unsere
Ladung im Auto erklären. Außerdem will der Chef der Sicherheitsfirma und die
Polizei mit uns sprechen. Sie begründen dies mit der Sicherung amerikanischer
Einrichtungen gegen El-kaida-Aktionen. Und ein Schweizer und ein Deutscher, die
beide aus dem Nichts, völlig ohne Kontrolle auftauchen - sehr verdächtig.
Sie
lassen uns trotzdem laufen.
Der
dazugehörige Ort heißt Sangarédi. Wir durchqueren erst den wohlhabenden Teil -
hier wohnen wohl die Fachleute - hier gibt es Teerstraßen. An einer Kreuzung
müssen wir stoppen, weil ein langer Konvoi, ausschließlich Allradautos,
Vorfahrt bekommt. Dann bekommen wir wieder die übliche Piste und Guinea hat uns wieder. Der
Ort ist wieder typisch, trotzdem recht groß, aber wohl nur für Geologen
spannend. Dafür wird man hier am Ortsausgang noch einmal extra kontrolliert. Ab
jetzt folgt eine breite, sehr staubige Piste, die sich mit 100 Sachen fahren
lässt. Es staubt fürchterlich, besonders bei Gegenverkehr.
In
Boké, wo wir noch einen "cafe avec mayonnaise" plus Fleisch zu uns
nehmen und uns dabei von einem Einheimischen voll quatschen lassen, ändert sich
die Straße in eine gute Asphaltstraße.
Wir
fliegen so dahin. Die Landschaft wird flacher. Rechts und links ist Buschwerk
und einige Wäldchen, in der Ferne sehen wir noch die Berge. Es weist nichts auf
die nahe Küste hin. An den Straßenrändern liegt Wäsche und auf Unterlagen Maniokstücke
zum Trocknen auf dem heißen Asphalt. Oft sieht es aus, als würden wir da glatt rüber fahren. Wir fliegen so schweigend vor uns hin. Wir sind beide von der
gestrigen Piste erschöpft und gerade dann finde ich es besonders schwierig
französisch zu parlieren.
Am
frühen Nachmittag erreichen wir Boffa. Hier will Xavier einen Pfarrer aus der
Schweiz besuchen und hier trennen wir uns. Der Ortsmittelpunkt mit dem
"gare routière" ist gleichzeitig der Anleger für die Fähre über den
Fluss "Fatale". Xavier fährt parallel zur Warteschlange ran und wird
schon von anderen Fahrern angemeckert. Er erklärt sich, und denen, dass ich eine
Passage nach Conakry suche. Alles klar und ehe ich mich versehe, finde ich mich
in kürzester Zeit mit Hilfe eines Militärs(!) und einigen freundlichen Menschen samt Gepäck als
dritter und letzter Passagier in einem Mercedes-PKW wieder. Klasse. Zwar müssen
wir auf die dritte Fähre warten, aber alle sind nett und die Wartezeit ist
trotz der Affenhitze erträglich.

In
der Schlange neben uns sitzt zum Beispiel ein Guineer, der lange in Frankreich
gelebt hat, dort als Student die 100m unter 11m Sekunden gelaufen ist, mit
einer Frau mit deutschen Vorfahren verheiratet war und selbst einen
griechischen Großvater hat. Er hat tatsächlich sehr untypische Gesichtszüge.
Die
Fähre ist fix, natürlich mit dem üblichen Chaos drüben - ein Auto musste richtig
in seine Position geschaukelt werden. Mit lautem Gehupe bahnen wir uns den Weg
durch die Menschenmassen, die auf der anderen Seite wuseln. Und hier ist eine
superlange Schlange, die auf die eine Fähre wartet. Die werden wohl noch bis in
den Abend warten. Das mit dem Hupen ist übrigens sehr gewöhnungsbedürftig. Erst nervt das, aber dann stelle ich fest, das
die Leute hier irgendwie nicht mitkriegen, wenn ein Auto kommt - sie latschen
einfach auf die Straße. Wir sausen jedenfalls mit Höchstgeschwindigkeit, laut
hupend, so dahin. Überqueren hier und da kleine Flüsse. Neben der Straße
wachsen jetzt zunehmend Palmen. Ein Fluss muss vierfach, vier Seitenarme, mit vier
gelben, einspurigen Brücken überquert werden.
In
den Vororten von Conakry wird es chaotisch. Viele Märkte, viel Gestank, viel
Stau, viel Dreck. Die Leute im Mercedes suchen mir ein Taxi, handeln den Preis
für mich aus und schärfen mir ein, nicht mehr als 8.000FG zu bezahlen. Viel
Geld, aber wir fahren seehr lange durch die Vororte, stehen seehr lange im Stau
und finden seeehr spät das Hotel Mariador, welches mir Ulrike in Labé empfohlen
hat. Im Mariador-Palace, es gehört zur Meridien-Kette, kostet ein Zimmer 120
US$. Ähem, gibt es nichts billigeres? Klar doch, im Mariador-Residence, für
65.000FG. Gesagt, angerufen, gebucht und ein Taxi gerufen (das ist zu weit -
1000m - können Sie mit dem Gepäck nicht laufen). Ich erinnere mich dunkel an
Ulrikes Informationen und frage, wieviele Mariadors es denn gibt. Drei, es gibt
noch das Mariador-Park, noch billiger. Es kostet 58.000FG, dafür ohne Pool. Für
die 500 Meter nimmt der Taxifahrer richtig Geld. Egal, ich kann ausgiebig
duschen und schlafe heute Nacht mit Aircondition. Abends gehe ich noch
Pizza-Essen. Der Weg dahin führt an einer fürchterlichen Straße mit viel
Verkehr entlang. Die Pizza ist teurer als in Labé (9.500FG), dafür kann ich auf
dem Rückweg in einem Cyber-Café noch ordentlich surfen.
Die
Nacht ist in meinem Zimmer ganz angenehm. Ich habe sogar einen Fernseher. Hier
gibt es drei Programme. Darunter ein Lokalsender - also für ganz Guinea - mit
Video-Amateur-Bildqualität und - echt pervers - eine RTL-Variante mit
Telefonsex-Werbespots für Frankreich und die Schweiz.
Ich
bin aber hier in Conakry unzufrieden. Als ich am nächsten Tag stadteinwärts
gehe, bin ich völlig frustriert. Das ist wirklich ein Dreckloch und dazu noch
laut und nervig. An fast allen Straßen sind rechts und links Verkaufsstände im
Dreck, einen Fußweg gibt es nicht. Man muss ständig daran vorbeilavieren.
Dauernd wird gehupt und dauernd ist man im Weg. Es gibt übrigens besonders viele
Albinos in Conakry. Und abends gibt es vor jedem Hotel und jedem
"club", jenen Bretterbuden mit lauter Musik, Prostitution. Um nicht
so lange in der Hitze herumzulaufen und abends nicht dauernd angequatscht zu
werden ist eine Fortbewegung nur per Taxi möglich, um trotzdem laufend im Stau
zu stehen. An den schlimmsten Staustrecken haben sich ganze Regimenter von Bettlern
postiert. Die Autofahrer fahren außerdem wie die Henker.
Ich
suche die Botschaft von Sierra-Leone. Vielleicht gucke ich in das Land doch
noch einmal rein. Ich warte auch eine Stunde, zunehmend genervt, weil sich
nichts rührt, bekomme irgendwann ein Formular und nehme es mit. Zu diesem
Zeitpunkt habe ich den Plan aber schon wieder fallengelassen. Dieses Land hat seinen
Bürgerkrieg seit 6 Monaten hinter sich. Hier wird wohl noch vieles nicht
funktionieren. Es soll zwar mittlerweile sicher sein, aber wer weiß das schon.
Dafür will ich morgen in der Botschaft von Mali mein Visum ändern lassen. Mit
einem weiteren Taxi fahre ich ganz in die City. Es ist eine hektische Fahrt,
kreuz und quer, immer um die schlimmsten Staus herum. Der Fahrer kennt sich
aber ganz gut aus. Da Conakry-City auf einer schmalen Landzunge liegt, sind wir
meistens in Meeresnähe mit stark heruntergekommenen Promenaden, die aber
niemand mehr benutzt. Ein Fischer verkauft seinen Fang an der Straße. Damit man
seine Fische besser sieht, hat er sie an einen Baum gebunden.
Die
Bank BiCiGui arbeitet mit VISA zusammen. Ich stelle mich an eine Schlange, um
dann nach einer halben Stunde hören zu müssen, dass die Schlange einerseits die
Falsche und es andererseits einen Geldautomaten gibt - na Klasse. Erst beim
zweiten Versuch fällt mir die Geheimzahl wieder ein. Ein Mann spricht mich an,
gibt mir die Hand, ich denke "schon wieder so ein Vollquatscher",
dann erkenne ich ihn wieder als einer von den netten Leuten aus dem Mercedes
von gestern. Ist mir peinlich. Es ist immer noch schwer für mich, die
Afrikaner auseinander zu halten. Ein gehe noch ein bisschen herum, bin aber
schnell genervt und fahre zurück ins Hotel. Der Strom und das Wasser sind noch
abgestellt und der Zimmerservice noch beim arbeiten. Das Mädchen wundert sich,
warum mein Handtuch von gestern schon so dreckig ist. Na ja, es ist der rote
Staub, der wie eine zweite Haut auf meiner Haut klebt.
Hier
sind zwar auch noch andere Leute im Hotel, nur sind es keine Touristen. Nur
Leute von Hilfsorganisationen, die es natürlich auch hier zuhauf gibt und die
tagsüber arbeiten. Das ist für mich besonders langweilig. Die Umgebung und auch
der Strand ist auch nicht so prall - ich will hier weg. Nachmittags versuche
ich noch eine E-mail an Nicolas auf französisch vorzubereiten. Ich hoffe, er
versteht, was ich ihm schreibe. Zur Zeit ist das "dictionaire" mein
wichtigstes Buch.
Abends
gehe ich über den Hotelanschluss ins Internet. Gibt mal wieder etwas Post. So
kann ich auch gleich meinen letzten Krankenstatus weiterreichen.
Nachts
gucke ich fern und überlege wie ich weiterreisen werde.
Morgens
fahre ich gleich mit dem Taxi zur Botschaft von Mali. Ohne warten zu müssen,
erklärt mir ein hoher Botschaftsangehöriger, dass das mit meinem Visum kein
Problem ist. Das Datum sagt nur meine ungefähre Ankunftszeit aus. So kann ich
also getrost meine Planung überarbeiten und morgen verschwinden.
Im
Internet-Café, bricht dauernd die Leitung zusammen. Das nervt, zumal ich gerade
einen neuen Rundbrief schreibe und diese bei mir recht lang ausfallen. Hinzu
kommt, dass ich den Text bereits auf meine Jornada vorbereitet habe und dem nun
ausgerechnet der Saft ausgeht. So sende ich mir den Entwurf erst einmal selbst
zu, um abends weiter zu schreiben. Der Jornada kann dann wieder aufladen.
Nachmittags
lese ich endlich mein Buch zu Ende. "Endlich" ist eigentlich falsch:
Es ist der "Chronist der Winde", ein Buch, an dem ich mich gar nicht
satt lesen kann.
Das
Abendessen nehme ich mal wieder in einem der Straßenrestaurants ein, diesmal
ausnahmsweise auf richtigen Möbeln. Wieder im Hotel, beim Reisebericht tippen,
setzt sich ein Mädchen an den Nebentisch und bietet Massagedienste an. Sie
meint, sie benutzt sogar die doppelte Lage Kondome. Die Hauptmarke heißt hier
"Prudence". Nach einigen vergeblichen
Werbeversuchen geht sie wieder und ich gehe an den hoteleigenen PC. Nur mühsam
kommt per Modem eine Verbindung zustande. Es dauert ewig und beim Seitenaufbau vergehen Jahre. Es gelingt mir dann aber doch, den Rundbrief weiter zu
schreiben, als die Verbindung zusammenbricht und, bevor ich den Text irgendwie
sichern kann, der zuständige Kollege nichts besseres zu tun hat, als die
Programme neu zu starten. Alles wieder weg - "merde". Beim dritten
Versuch, jetzt bin so richtig genervt, klappt es dann endlich.
Um
mich zu beruhigen gehe ich noch mal draußen rum - hier wird man tatsächlich
alle 5 Meter von völlig fertigen Mädchen angesprochen. In einem Club haben sie
ganz gute Musik, sie spielen die neue CD von Salif Keita. Die werde ich mir bald zulegen
müssen. Vielleicht als Kassette in Mali.
Die
letzte Nacht in Conakry geht so. Ein paar mal bricht die Elektrizität zusammen,
aber das ist ja normal.
Morgens
lasse ich mich sogleich zum "gare routière"-nach-Kindia bringen. Der
Taxifahrer kurvt ewig lange durch die Stadt und lässt mich auch noch einen
halben Kilometer zu früh raus. Trotzdem komme ich an und befinde mich sofort in
einem Wagen nach Kindia. ich kaufe zwei Plätze und mache mich vorne breit. Das
Auto ist noch relativ neu, füllt sich schnell (hinten quetschen sich alle
zusammen) und los geht es. Stadtauswärts quälen wir uns von Stau zu Stau, vorbei
an stinkigen, schlammigen Märkten und brennenden Müllhalden. An der Stadtgrenze
muss ich als einziger aussteigen. In einem besonderen Büro werden mal wieder
mühsam meine Daten notiert. Dafür darf ich dann 3.000FG berappen. Ich muss mich
mühsam zusammenreißen, frage aber doch, wofür das Geld ist. Die Beamtin meint, damit ich
überhaupt weiterfahren darf!!! Klasse.
Irgendwie
bin ich fertig mit diesem Land. Ich habe keine Lust mehr, bin genervt und will
hier raus. Guinea ist sehr schön, hat nette Leute und ein gutes Klima. Kann
denn niemand diese uniformierten Blutsauger abschaffen? Meine Stimmung hebt
sich etwas, als wir die letzten Stadtausläufer verlassen und sich eine schöne
Hügellandschaft ausbreitet. Bis der Fahrer merkt, dass er lieber ein Rennfahrer
ist und wie wahnsinnig in die Kurven rauscht. Und das bei einer Straße mit
unbefestigtem Rand, wo es oft an einer Seite tief runtergeht. Jetzt weiß ich
auch, warum er sich anschnallt, was hier eigentlich niemand macht. Nun bringt
es doch nicht so viel Spaß. Dafür kommen wir aber in Rekordzeit an.
Kindia
ist zwar nicht die Welt. Wenn es aber ein nettes Hotel gibt, bleibe ich für
eine Nacht.
Bei der Einfahrt auf den Markt, wo alle Buschtaxis halten und abfahren, wirft sich ein Geier todesmutig vor das vor uns fahrende Auto. "Knack", das war's. Mein erster Eindruck von Kindia.
Dann mache ich einen Fehler, in dem ich
nach einem sehr guten Hotel frage. Sofort wissen welche Bescheid und mit einem
Taxi werde ich dahin gebracht. Es heißt "Buffet de la Gare" und hat
seine beste Zeit vor ca.60 Jahren gehabt. Da gehe ich gar nicht erst rein. In
meinem Reiseführer wird das Hotel "Phare de Guinée" als sauber und
gut erwähnt. Wieder bringt mich ein Taxi hin (das kostet natürlich jedes mal Geld) und
was ich sehe, ist gar nicht "erleuchtend". Dreckige Zimmer mit
schmutziger Bettwäsche, dicken Schimmelflecken, nicht abgespülten Toiletten,
vollen Aschenbechern, dreckiger Fußboden und Kakerlaken. Das und noch viel mehr
für zwischen 20.000 und 30.000FG. Die sind hier nicht ganz dicht. Den Manager
frage ich, warum hier denn alles so dreckig ist und warum denn niemand sauber
macht und lüftet. Er meint, die Reinigungskraft ist krank und der
"patron" nicht da. Ich habe
mir noch alle Zimmer zeigen lassen und mich trotzdem entschlossen
weiterzureisen. Diesmal im Sammeltaxi zum Markt, wo die Autos ankommen und zu
Fuß auf die andere Seite, wo die Autos abfahren. Jedes mal mit dem schweren
Rucksack (na ja, ein paar Tage noch). Hier finde ich einen Platz nach Mamou. Es
braucht zwar etwas Zeit, bis das Buschtaxi, ein kleiner Bus, voll ist, dafür
ist auch der recht neu und vorne gut Platz für drei Personen. Neben mir sitzt
ein alter Mann in der typischen Moslem-Kluft. Die ganze Fahrt popelt er in der
Nase und rotzt an mir vorbei aus dem Fenster. Solange bis ihn der Fahrer darauf
aufmerksam macht, dass seine Rotze vielleicht im nächsten Fenster wieder
reinkommt. Er ist aber bockig. In seinem Alter verbietet ihm so was keiner. Das
mit dem Gerotze ist ohnehin so eine Sache. Immer wieder wird geräuschvoll
Spucke und Schnodder hochgezogen, im Mund zu einer ansehnlichen Menge gesammelt
und dann in einem richtigen Schwall aus dem Mund gepresst. Das sieht manchmal
sogar richtig kunstvoll aus, ist aber in Wirklichkeit ekelig.
In
Mamou kenne ich mich ja schon aus. Zielgerichtet finde ich ein gutes Hotel. Bei
meinem letzten Aufenthalt hatte ich ein Schild "Hotel Rama" gesehen.
Gemeint habe ich aber ein anderes Hotel, welches auf jeglichen Hinweis in
eigener Sache verzichtet und "Hotel Africa" heißt. Diese Hotel ist
ziemlich neu, hat noch kein Restaurant und keine Bar und ich bin der einzige
Gast. Vor der Tür liegen zwei Leute. Es sind
Arbeiter, die um 17.00 ihre Siesta halten. Auch sonst ist alles
schläfrig. Die Zimmer sind aber sehr gut, obwohl auch noch nicht ganz fertig.
Das werden sie auch nie, denn genauso wie nichts so richtig fertig wird, gehen
schon frühzeitig die ersten Dinge kaputt. Das Hotel ist superbillig gebaut und
sieht nur gut aus, weil es neu ist. Nach spätestens der zweiten Regenzeit wird
es nur noch schimmeln.
Ich
gehe noch in den Ort, in der Hoffnung eine Internet-Verbindung zu bekommen. Es
ist aber wie beim letzten mal - keine Verbindung. Das Telefonnetz geht noch
immer nicht.
So
erforsche ich Mamou etwas und gehe einige Wege hin und her. In einem Kino
werden Aufzeichnungen von Fußballspielen gezeigt - man muss ja die Männer
irgendwie beschäftigen, solange ihre Frauen schuften. Ich setze mich für eine "American Cola" vor
ein Café. Ein Pick-Up fährt vorbei. Beladen mit zwei Rindern auf der Ladefläche
und zwei Rindern und einer Ziege auf dem Dach. Die Rinder hat man auf die Seite
gelegt und die Hörner am Dachgepäckträger festgebunden. So ist das mit den
Tieren. Sie sind nichts anderes als lebende Nahrungsdepots. Solange sie leben -
wie ist egal - ist das Fleisch frisch.
Auf
dem Weg zurück gehe ich mal in das richtige "Hotel Rama", mal sehen,
ob die eine Küche haben. Da auch hier die gleichen Fußballspiele laufen, nimmt
niemand Notiz von mir. Ich esse auf dem Markt, komme ins Gespräch mit einem
liberianischen Flüchtling, der mich am Ende auch gleich anpumpt und gehe zum
Schreiben in mein Hotel zurück. Auch hier: Fußball. Wenigstens wird der
Generator nicht nur für mich benutzt.
Gleich
morgens mache ich mich auf den Weg zum "gare routière"-nach-Faranah.
Ein Auto ist schnell gefunden. Leider bin ich der erste. Also warten. Ich kann
erst einmal in Ruhe frühstücken gehen und mir sonstwie die Zeit vertreiben.
Langweilig. Währenddessen kommen immer wieder alte blinde Männer, die an ihrem
Stock von Kindern geleitet werden. An den Taxis halten sie an, das Kind zappelt
unbemerkt vom alten rum, während dieser monoton seinen Betteltext runterleiert.
Dafür erwartet er dann Geld. Dies passiert einige male - es gibt offenbar viele
blinde Alte hier.
Nach zwei Stunden ist es dann soweit. Wir fahren 100m um zu stoppen. Der Fahrer meint, er könne auf dem Dach seines Wagens - er hat keinen Dachgepäckträger - noch eine große Matratze mitnehmen. Befestigen will er sie durch die offenen Fenster drinnen. Zum Glück merkt er noch rechtzeitig, dass dann keine Türen mehr aufgehen. Jedenfalls setzt sich im letzen Moment noch eine vierte Person in die Vorderreihe, ein Junge wird noch dazugereicht, der Fahrer quetscht sich hinterher und los geht's. Mist - schon wieder so ein verhinderter Rennfahrer. Er überholt auf einer kurzen Steigung - ohne zu ahnen, was entgegenkommt - mühsam einen fast gleichschnell fahrenden Laster. Absolut nicht ganz dicht. Als er es ein weiteres mal probiert, aber zum Glück noch rechtzeitig merkt, dass er scheitern würde, mache ich Witze über ihn. Anders ist die Situation nicht zu ertragen. Zum Glück gibt es hin und wieder einige Schlaglöcher, bei denen er langsamer fahren muss.
Oft wechselt die Landschaft von sattem grün zu
trockenschwarz - nämlich immer dann, wenn Buschbrände das Land
"gereinigt" haben. Dann wird das lange trockene Buschgras vernichtet
und dafür kommt kurz etwas grünes Gras durch - für die Rinder und Ziegen. Viele
Dörfer ziehen vorbei. Jetzt sind es hauptsächlich traditionelle Rundhütten. Je
weiter wir nach Osten fahren gesellen sich noch kleine Türmchen, die
Vorratsspeicher, dazu.
Einige
Male kommen uns lange Konvois des UNHCR entgegen. Lastwagen voller Menschen,
wahrscheinlich Flüchtlinge aus Côte d’Ivoire oder Flüchtlinge aus Sierra Leone,
die von Banditen im Grenzgebiet überfallen worden sind und umgesiedelt werden.
Es gibt natürlich wieder eine Polizeikontrolle, die sind ja schließlich hinter jedem Ort. Ein Uniformierter kommt ans Fenster und verlangt von allen die "carte d’identité de Guinée". Zwei Frauen mit kleinen Kindern neben mir haben nur einen gestempelten Zettel und ich natürlich alles andere, nur keinen Personalausweis von Guina, also was soll der Unsinn. Als ich mich deswegen doof stelle macht ein Mitreisender, der vierte in unserer Reihe, daraufhin trocken die Bemerkung, was der ganze Unsinn mit den Ausweisen soll, und warum der Uniformierte nicht einfach seine Arbeit macht.
Daraufhin, er hält dummerweise meinen Pass in der Hand, bekommt der einen Wutanfall. Er läuft wie ein brünftiger Gorilla herum und ich fürchte jedes mal um meinen Paß. Er schreit
herum, und besonders den vierten in der Reihe an, was ihm einfiele ihn zu
unterbrechen, wenn er einem Weißen eine Frage stellt, er sei ja wichtig hier
und verantwortlich etc. Er wird nicht sonderlich ernst genommen, der vierte
steigt aus und erklärt ruhig und immer wieder, mit einem schrecklich
spöttischen Gesichtsausdruck, wie er das gemeint hat. Er soll doch bloß seine
Arbeit machen, sonst nix. Daraufhin steigert sich seine Wut und so geht es noch
einige Minuten. Da ich ernsthaft um meinen Pass fürchte, versuche ich
beschwichtigend zu wirken, aber der Typ will sich aufregen, gibt den Pass aber
wenigstens seinem Kollegen, der kurz reinguckt und mir ihn feixend wieder zurück gibt.
Jetzt machen auch die beiden Frauen neben mir Witze darüber und prompt müssen
sie aussteigen. Der Wagen darf hinter die Absperrung. Alle restlichen Insassen
- schließlich sitzen vorne auch vier Erwachsene und ein Kind - steigen jetzt
aus und wir gehen geschlossen zurück, um die restlichen drei mit ihren Kindern
abzuholen. Das klappt dann auch und wir können weiter.
Vor
Faranah überqueren wir den Niger, einem winzigen Flüsschen. Auch diesmal habe
ich kurze Etappen gewählt. Vielleicht ist ja Faranah ganz nett. Schon wieder
frage ich einen Einheimischen nach dem besten Hotel, werde für viel zu viel mit
einem Taxi eine kurze Strecke transportiert, sehe wieder mal ein richtiges
Dreckloch und beschließe weiter zu fahren. Es ist frustrierend. Wieso kann ein
Hotel nicht auch einmal freundlich aussehen und wenigstens auch mal sauber
sein.
Auf
dem Weg zurück zum Markt werde ich angesprochen, einen Ausflug in den nahen
"Parc National de Haut Niger" zu machen. Es gibt Pirogenfahrten über
die Flüsse, aber - ich bin erst hin- und her gerissen - ich denke es ist zwar
nett aber noch netter nach der Regenzeit - und ich habe genug von Faranah.
Am Markt frage ich erstmal den Fahrer des neuen Buschtaxi, was er von Rennfahrern hält und ob er auch wie ein bekloppter in die Kurven rauscht. Das trägt natürlich zur allgemeinen Belustigung bei. Die Antwort bleibt daraufhin sehr vage.
Auch hier muss ich warten. Irgendwann sind wir aber genug Leute - diesmal acht Leute ohne Kinder, dafür springen noch schnell zwei Leute aufs Dach. Diesmal kann ich die Fahrt genießen. Es ist angenehm, mit dem Platz kommen wir ganz gut klar. Wieder erreichen wir eine Polizeikontrolle. Wieder werde ich gezielt angesprochen. Ich verstehe, er will von mir alle Papiere, inklusive eines "Carnet de vacances". Ich denk, was soll denn der Müll. So was gibt es doch überhaupt nicht. Ich bereite mich also darauf vor, mich aufzuregen und gehe in Touri-Abzocke-Abwehrstellung. Nach einigem Wortwechsel macht der Polizist die Andeutung einer Impfung und ich verstehe, was er meint: meinen Impfpass. Das letzte Wort heißt nämlich "Vaccination". Dazu muss man wissen, das man Guinea ein besonderes Französisch spricht. Man verschluckt nicht nur die letzten Silben, sondern spart auch in der Mitte eine ganze Menge. Gerade wenn man die Sprache nicht beherrscht, braucht es drei Anläufe, um zu verstehen.
Endlich geht es weiter. Auch jetzt begegnen uns UNHCR-Konvois. Diese
Organisation ist in dieser Region sehr stark vertreten. Bis auf einen kochenden Kühler kommen wir
gut durch.
In
Kissidougou werde ich die Nacht verbringen. Es wird allmählich dunkel. Ich frage
nach dem besten Hotel und werde sofort wieder begleitet. Es ist übrigens fast
unmöglich etwas alleine zu finden. Also begleitet mich ein Biologielehrer aus Kissi, wie der Ort hier genannt wird, zum "Hotel Nelson Mandela". Eigentlich
ist der Weg nicht sehr weit - mit Gepäck ist er aber eine Qual. Es ist heiß,
drückend und ich bin schlechter Laune. Immer wieder nerve ich rum, ob das Hotel
überhaupt existiert. Ich will endlich duschen. Wir kommen natürlich an,
allerdings um zu erfahren, dass nicht nur dieses, sondern auch alle anderen
Hotels in Kissi komplett ausgebucht sind. Scheiße. Das kann doch nicht wahr,
wieso gerade ich. Völlig fertig stehe ich Hotelrestaurant und muss erst einmal
etwas trinken. Gibt es wirklich keine Chance auf ein Zimmer? Ich sehe jetzt
bestimmt mitleidserweckend aus. Die Rettung naht in Person von Mio, dem
Hotelfaktotum. Er überlässt mir sein privates Zimmer. Supernett. Es ist zwar
reichlich schmutzig, sein Bett wird aber frisch bezogen. Duschen kann ich im
Restaurantgebäude (hier ist alles in Bungalowweise gebaut) in einem Raum, der
sonst als Klo benutzt und nach Pisse riecht, aber mit meinen Badelatschen macht
mir das nichts. Mir geht es schon besser, ich bin total fertig, werde nur noch
etwas essen und dann ins Bett fallen. Als meine Taschenlampe einmal unter das
Bett rollte, sehe ich, dass es wirklich dreckig ist. Trotzdem schlafe ich ganz
gut.
Am
nächsten morgen bekomme ich ein richtiges Zimmer mit Bad. Auch hier ist es
wieder das gleiche Problem. Das Zimmer ist aber wenigstens gefegt. Die
Einrichtung ist aber schon ziemlich heruntergekommen. Mit etwas Farbe wäre hier
schon viel erreicht. Egal, die Leute sind wahnsinnig nett und ich will erst
morgen weiter. Vormittags erkunde ich Kissi. Es ist drückend heiß, am
Marktplatz sammeln sich viele Menschen und Leute, Jäger, in traditioneller Kleidung, ausgestattet mit
altertümlichen Flinten, stehen Spalier.
 Kurz
darauf kommt ein Konvoi mit superwichtigen Leuten vorbei, Ich höre, es ist eine
Kampagne zur Wiederwahl des Präsidenten. Dazu muss man sagen, dass der Präsident
sehr krank ist und auch schon in aller Öffentlichkeit in Ohnmacht gefallen ist.
Er befindet sich gerade in Marokko in einem Krankenhaus. Damit man ihn nicht
vergisst, muss er sich alle paar Wochen zeigen. Also düst er kurz nach Hause und
dann zurück in die Klinik. Der Wahlkampf wird also ohne ihn geführt. Deswegen
gab es hier wohl auch keine Hotelzimmer.
Kurz
darauf kommt ein Konvoi mit superwichtigen Leuten vorbei, Ich höre, es ist eine
Kampagne zur Wiederwahl des Präsidenten. Dazu muss man sagen, dass der Präsident
sehr krank ist und auch schon in aller Öffentlichkeit in Ohnmacht gefallen ist.
Er befindet sich gerade in Marokko in einem Krankenhaus. Damit man ihn nicht
vergisst, muss er sich alle paar Wochen zeigen. Also düst er kurz nach Hause und
dann zurück in die Klinik. Der Wahlkampf wird also ohne ihn geführt. Deswegen
gab es hier wohl auch keine Hotelzimmer.
Präsidenten
in Afrika haben natürlich auch keine Stellvertreter, sonst wären sie ja
ersetzbar und man könnte sie einfach umbringen. Wenn also ein Präsident krank wird und
stirbt, entsteht ein Vakuum, das erst nach internen Machtkämpfen gefüllt werden
kann. Also ist das Militär verständlicherweise nervös.
Die
Innenstadt, auch hier ist ausschließlich Markt, ist trotz der Hitze ganz
angenehm. Die Händler lassen einen in Ruhe gucken und wenn sie etwas nicht
haben, drängen sie einem nicht ihre Hilfe auf.
An
einer Stelle flechten sich ein dutzend Frauen gegenseitig kurze Zöpfe ins Haar.
Sieht witzig aus. Ich bin selten so entspannt über einen Markt gelaufen. Ich
treffe noch Anne, ein Mädchen, welches gestern Abend bei der Zimmergeschichte
behilflich war. Sie arbeitet in einem (Freiluft)-Friseurladen. Ich sehe sie ein
zweites mal, wie sie ihrer Cousine Zöpfe flechtet.
Auf
dem Markt kaufe ich für Mio eine chinesische Taschenlampe, als Geschenk. Er
freut sich riesig und läuft für den Rest des Tages damit herum.
Auf
dem Rückweg hält plötzlich Xavier mit seinem Nissan Patrol. Welche
Überraschung. Vielleicht sind die nervigen Tage in überfüllten Buschtaxis ja
vorbei. Ich spekuliere etwas auf einen freien Platz bei ihm (was auch klappt)
und plane mal wieder eine neue Route. Abends werde ich ein paar mal
angesprochen, ob wir nicht einen Platz nach Mali frei haben. Es ist wohl
einigen sehr wichtig, dieses Land zu verlassen. Als ich abends den Manager auf
den armseligen Zustand des Hotels anspreche reagiert er ähnlich. Hier werden
vom Besitzer ein mal die Woche die Einnahmen abgeschöpft und nichts in das
Hotel gesteckt. Das ist ziemlich frustrierend. Auch er würde lieber jetzt als
später dieses Land, welches so reich ist und doch so arm, verlassen. Er meint,
dass hier früher oder später alles den Bach runter geht.
Am
frühen Abend taucht Hirito, ein, in Australien lebender, fröhlicher Japaner mit
seiner 250er Suzuki auf. Er ist seit vier Jahren damit in der Welt unterwegs.
Wir tauschen lustig Reiseinformationen aus.
Die
Nacht ist heiß, ich schwitze wie ein Schwein.
Morgens
machen Xavier und ich uns auf den Weg nach Kankan. Die Straße ist fürchterlich,
es hat sehr viele Schlaglöcher. Hier und da kommt eine Polizeikontrolle, aber
kein Schwein interessiert sich für uns. Komisch, als ob sich die Polizei hier
nur für Weiße in Buschtaxis interessiert. Vielleicht ist das gar nicht erlaubt.
Xavier meint, er ist auf der ganzen Strecke nicht einmal behelligt worden.
Die
Landschaft ist weniger interessant. Sie ist flach und trocken. Gelegentlich
fahren wir durch ein Dorf, die kleinen Türmchen gibt es immer öfter. Die Dörfer
sind durch interne Zäune in kleine Einheiten aufgeteilt. Gelegentlich ersetzt
eine Autotür die Eingangspforte. In einem der Dörfer trinken wir eine Brühe,
die man hier Kaffee nennt (ohne Mayonnaise) und ich stelle verblüfft fest, dass
viele Männer hier arbeiten und z.B. an den Nähmaschinen sitzen. Außerdem fällt
auf, dass tatsächlich in jedem Dorf ein kaputter Traktor steht. Es war wohl mal
eine Spende, ging irgendwann "en panne" und rostet seit dem endgültig
vor sich hin. Kurz vor Kankan passieren wir zwei Buschtaxis, eines hat eine
Panne. Xavier wendet um zu fragen, ob er helfen kann. Am liebsten wären alle
auf seinem Dach mitgefahren. Das geht aber nicht - leider.
Kankan
erreichen wir bereits am frühen Nachmittag. Wir mieten und im "Hotel
Calao" ein. Hier gibt es saubere Zimmer mit Komfort wie z.B. Aircondition
für 25.000FG. Na also. Hoffentlich haben wir morgen auch so ein Glück. Nachts
macht die Aircondition allerdings so einen Höllenlärm, dass ich sie abschalte.
Kankan
hat einen sehr großen Markt und ist natürlich auch schon sehr heruntergekommen.
Auf einem Stadtplan wird noch großkotzig mit einem Krokodilbecken geworben. Das
arme Reptil ist wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten an Hunger gestorben. Das
Gelände ist eine einzige Müllhalde. Überhaupt ist es sehr schmutzig. Am Fluss
Milo ist ein, so im Stadtplan ausgezeichneter, Aussichtspunkt. Man guckt auf
eine große Brücke, auf den noch sehr flachen Fluss, wo Autos und Kleidung
gewaschen werden. Sieht ganz nett aus. Auch die paar zugekifften Freaks, die da
rumlungern stören nicht groß, solange sie einen nicht voll quatschen. Den Markt
aber mag ich besonders. Das Marktgeschehen bringt Spaß, man kann relaxed gucken
und ich kaufe einige Musikcassetten. Später erstehe ich auch noch einen
passenden Walkman.
Hier
werden chinesische Produkte verkauft, deren Namen aus abgewandelten, bekannten
Markennamen bestehen. So heißt mein Walkman "Nokina". Er ist
natürlich völlig überteuert. Der Händler ist viel zu freimütig beim Handeln,
schenkt mir auch Extra-Batterien dazu und feixt sich einen.
Jetzt
habe ich aber das, was ich schon lange vermisse: Musik. Es ist tatsächlich so.
Zuhause höre ich viel Musik und seit ich in Afrika bin, gar nicht. Da stimmt
was nicht. Die hiesige Musikszene ist sehr bekannt - viele Namen kenne ich auch
in Europa. So sitze ich vor meinem Hotelzimmer und träume so vor mich hin. dass
der Walkman grauenvoll klingt und vor sich hin brummt, ist auch okay.
Ein
Hotelangestellter spricht mich an, ob ich nicht einen Frau suche - so für ne
Stunde. Kurz darauf taucht auch aus dem Halbdunkel eine Frau auf, die sich mir
anbietet. Sie preist ihre Vorzüge und ihr Können und zeigt, um den Eindruck
noch zu verstärken, ihren Busen. Tut mir ja leid, aber da ich die beste
Freundin der Welt habe, und genauso sage ich es ihr auch, lehne ich ihr Angebot
ab, was sie auch akzeptiert.
Am
nächsten Morgen, beim Frühstück, taucht sie im Hotel-Restaurant mit ihrem
kleinen Kind auf, begrüßt mich und gibt mir die Hand - wie alte Freunde.
Xavier,
der gar nicht Hotel genächtigt hat, und somit auch nicht seine Hotelrechnung
bezahlt, möchte noch einen Tag in Kankan ausruhen. Er wohnt in der
"mission catolique", wo es saubere Zimmer, mit Ventilator an der
Decke, für 20.000FG gibt. Ich packe also zusammen und stiefel los. Ich habe
Zeit genug und nichts gegen einen extra Tag einzuwenden. Es ist nett in der
"mission". Da ich Kankan bereits gestern ausgiebig ausgekundschaftet
habe, sitze ich vormittags faul herum, höre Musik und versuche mir die nächsten
Wochen mit Ruth in Mali vorzustellen.
Am
frühen Nachmittag erinnert mich mein Magen daran, dass ich seit dem Frühstück
nichts mehr gegessen habe. Damit es nicht langweilig wird will ich ein paar
andere Ecken von Kankan sehen. So gehe ich in Richtung des alten Bahnhofs,
einer Ruine aus früheren Tagen. Alles voller Müll und Dreck. Auf den großen
Haufen laufen Rinder und Ziegen und suchen zwischen all den Plastiktüten
Fressbares.
Es
laufen auffallend viele Soldaten herum.
Essstände
gibt es hier auch, aber irgendwie sagt mir das Angebot nicht zu. Oder es
passiert Folgendes: Ich betrete eines diese klitzekleinen Restaurants und
frage, ob es geöffnet hat. "Ja, natürlich". "Gibt es denn etwas
zu essen?" Der "patron" schaut ratlos auf ein sehr leeres
Lebensmittelregal, nestelt an der einen oder anderen Dose und sagt erst einmal
nichts. Er denkt aber, ich will Lebensmittel kaufen. "Nein, ich will
nichts kaufen, ich möchte das Sie etwas zu essen machen". "Ach so, da
an der Wand ist die Speisekarte". "Oh, klasse, wie wäre es denn mit
einem Omelette mit Brot?" (Ich versuche gerade weniger Fleisch zu essen)
Wieder schaut er ratlos ins Regal. "Es gibt wohl doch nichts zu essen,
oder?" "Ich glaube, ja". Daraufhin verlasse ich das
"Restaurant".
Dass
es es schwer ist, etwas zu essen zu bekommen, hat natürlich seinen Grund.
Selbst die großen Hotels verwalten eher den Mangel und haben dieselben
Probleme. Da es, wie in Guinea, nur in den Abendstunden Strom gibt oder, wie
auch in anderen Ländern, die Stromversorgung oft zusammenbricht, können
Lebensmittel nicht entsprechend gelagert werden. (Kaufe nie ein Eis in Afrika -
es könnte schon oft aufgetaut worden sein)
Also
kochen sie am liebsten Gerichte, die man vorher bestellt und deren Zutaten
möglichst frisch auf den Märkten gekauft werden. Hier legt sich niemand etwas
auf Halde. Es würde in diesem Klima schnell verderben.
Mit
knurrenden Magen gehe ich weiter, laufe kreuz und quer über den Markt, probiere
hier und da geröstete Bananen, und erreiche schließlich ein anderes Restaurant.
Ich gehe hinein, in einem Hinterzimmer sitzt eine junge Frau mit Kind.
"Hat das Restaurant geöffnet?" "Ja". "Was gibt es denn
zu essen?" "Brot mit Eiern". "Oh, klasse, das will ich
haben". Die Frau rennt hinaus und ruft ihren Mann, der wohl irgendwo mit
seinen Kumpels Maulaffen feil hält. Der tut auch gleich ganz wichtig, sagt
aber, er hätte keine Eier. "Wie wäre es mit Butter? (so nennen sie hier
die scheußliche Margarine)" "Na, dann doch lieber mit
Mayonnaise". Das bekomme ich dann auch zusammen mit dem üblichen Kaffee,
bestehend aus drei Esslöffeln gesüßtem Milchpulver, einem halben Teelöffel
löslichen Kaffee und heißem Wasser. Scheußlich süß. Das Ganze rächt sich
natürlich und in der "mission" brauche ich erst einmal einen Schnaps.
Abends kann ich aber wieder das "Skol"-Bier von den Bermudas trinken,
es gibt nämlich Bier in der "mission". Xavier und ich sitzen im
"salle de manger" gemeinsam mit Joachim, einem deutschen
Caritas-Mitarbeiter. Ich versuche eisern beim französisch zu bleiben, das ich
zwar ganz gut verstehe, aber weniger gut spreche.
Das
Frühstück ist nicht doll. Brot mit Margarine, dazu zuckersüßen Milchkaffee. Ich
komme noch mit Joachim ins Gespräch. Er ist auch schon mal monatelang alleine
durch Afrika gereist und kennt sich aus mit den Hochs und Tiefs, die man so
erleben kann. Gerade wenn man niemanden hat, mit dem man die Eindrücke teilen
kann, kann es ziemlich frustrierend werden. Nun habe ich mir natürlich auch
noch Guinea ausgesucht, wo es kaum Touristen gibt und wo man irgendwie
französisch spricht, was ich nicht so gut kann. Ein bisschen hoffe ich, dass es
bald besser wird.
Joachim
ist einer von diesen verständnisvollen Zuhörern, die man gerade bei den
sozialen Organisationen so häufig findet. Er sagt ich solle mich ruhig mal
melden, auch wenn es mir nicht so gut geht. Vielleicht mache ich das mal.
Xavier und ich setzen unsere Reise fort. Der Weg nach Siguiri ist hart, ausschließlich Piste. Allerdings stellen wir fest, dass die Regierung wohl doch noch etwas Geld sinnvoll verbauen will, indem sie eine große, neue Straße baut. Das hat zur Folge, dass wir immer neben einer Baustelle herfahren. Die Landschaft ist flach und man kann weite Flächen trockenes Land einsehen. Es ist kaum Verkehr, nur ganz wenig Buschtaxis. Vor Niandankoro treffen wir Menschen an der Straße, die alle nur in eine Richtung gehen. Wie eine Prozession. Es werden stetig mehr, alle sind beladen mit allem, was das Land so hergibt - in Niandankoro ist Markt. Dort angekommen, müssen wir uns mühsam einen Weg durch den Markt bahnen. Die Straße ist mit Lastwagen und Eselskarren verstopft. Hinter dem Ort ist ein Camp von chinesischen Arbeitern. Die Chinesen bauen gerade eine Brücke über den Niger, der hier unseren Weg kreuzt.
 Bisher wird der Fährverkehr mit einer
Vielzahl von Pirogen erledigt. Sie transportieren fast alles - außer Lastwagen.
Für PKW wird eine Doppelpiroge, zwei Pirogen, die zusammengenagelt sind, mit
zwei Extra-Holzbrettern ausgestattet. Seitlich am Strand herangefahren, fährt
das Auto seitlich herauf und steht quer zur Fahrtrichtung. Es ist natürlich
echte Arbeit für die beiden Leute, die mit Stangen diese "Fähre"
fortbewegen. Besonders, da der Niger nicht viel Wasser führt und somit an
Sandbänken regelmäßig richtige Staus entstehen, ist es eine Arbeit, die viel
Können erfordert. Wir haben trotzdem das Gefühl, dass der Preis mit 25.000FG zu
hoch ist.
Bisher wird der Fährverkehr mit einer
Vielzahl von Pirogen erledigt. Sie transportieren fast alles - außer Lastwagen.
Für PKW wird eine Doppelpiroge, zwei Pirogen, die zusammengenagelt sind, mit
zwei Extra-Holzbrettern ausgestattet. Seitlich am Strand herangefahren, fährt
das Auto seitlich herauf und steht quer zur Fahrtrichtung. Es ist natürlich
echte Arbeit für die beiden Leute, die mit Stangen diese "Fähre"
fortbewegen. Besonders, da der Niger nicht viel Wasser führt und somit an
Sandbänken regelmäßig richtige Staus entstehen, ist es eine Arbeit, die viel
Können erfordert. Wir haben trotzdem das Gefühl, dass der Preis mit 25.000FG zu
hoch ist.
Das Ausladen geht genauso gut, wie das Einladen und wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Jetzt begleitet uns der Niger ein Stückchen. In einer Ebene fließt er gemächlich, blau schimmernd dahin. Da er noch weinig Wasser führt, hat er auch noch viele Sandbänke. Kurz vor Siguiri kreuzt der Tinkisso, ein Zufluss des Niger, unseren Weg.
 Hier gibt es eine richtige Fähre und auch
hier bauen Chinesen eine Brücke. Wir müssen nicht lange warten und werden
schnell über gesetzt. In Seguiri finden wir nach einigen Versuchen und Handeln
das preiswerte "Hotel Baté", hoch über der Stadt, ruhig gelegen mit
Blick auf die Niger-Ebene. Das Management besteht aus einigen sehr
aufgeschlossenen jungen Männern, die nebenbei das Hotel - auch hier in
Bungalowform - vergrößern. Man rechnet mit einem Anstieg der Touristenzahlen,
obwohl wir wieder mal die einzigen sind.
Hier gibt es eine richtige Fähre und auch
hier bauen Chinesen eine Brücke. Wir müssen nicht lange warten und werden
schnell über gesetzt. In Seguiri finden wir nach einigen Versuchen und Handeln
das preiswerte "Hotel Baté", hoch über der Stadt, ruhig gelegen mit
Blick auf die Niger-Ebene. Das Management besteht aus einigen sehr
aufgeschlossenen jungen Männern, die nebenbei das Hotel - auch hier in
Bungalowform - vergrößern. Man rechnet mit einem Anstieg der Touristenzahlen,
obwohl wir wieder mal die einzigen sind.
Außerdem
zeigen die bisherigen Räume starke Schwächen. Als Xavier die Klimaanlage
anwirft gibt es mit lautem Knall einen Kurzschluss und er hat drei schwarze
Finger. Anstatt also das vorhandene in Schuss zu halten, wird lieber etwas Neues
gebaut - natürlich so einfach und billig wie möglich. Man kann ja in ein paar
Jahren neu bauen.
Durch
den Ausbau der Straße erhofft man sich aber einen Aufschwung. Siguiri ist
natürlich auch schwerreich - auch wenn es niemand sieht. In der nahen Umgebung
wird in großem Stil Gold abgebaut und jeden Freitag von der Ashanti-Gesellschaft mit einer Sondermaschine
nach Ghana geflogen.
Abends
fahren wir in der Stadt herum. Vor uns fährt eines dieser typischen größeren
Buschtaxis, ein japanischer Kleinbus. Sie werden oftmals mit lustigen Sprüchen
bemalt. Auf der Heckklappe steht: "Inspecteur Derrique". Auch hier
sieht man fern.
Wir suchen ein Restaurant für den Abend. Auf einer Anhöhe (Siguiri ist umgeben von Anhöhen) steht ein neues, teures Hotel, Hotel Djoma, welches aber auch schon erste Schwächen zeigt.
Hier gibt es sogar einige Sachen, die auf der Speisekarte
stehen. Ich bekomme eine Pizza und das Bier in Dosen. Es gibt sogar "Wernesgrüner
Pils". Dann wird der Strom zugeschaltet, die Lichter und die Kühlschränke
des Hotels gehen an. Jetzt hätte ich mit einem kleinen Lichtermeer bei dieser
Aussicht gerechnet. Aber, ich zähle fünf Lichter. Allein im Hotel leuchten wohl
fünfzig. Das einzig helle, was die Umgebung hergibt ist ein nicht unwesentlicher
Buschbrand auf der anderen Nigerseite. So ist das mit der Energie. Es gibt sie
nur Abends und dann nicht für alle. Das einzig Gute daran ist, dass sich die
Muezzine auf ihren Minaretten schon selbst durchsetzen müssen und nicht so
allgegenwärtig sind - ihre Brülltüten funktionieren nämlich mit Strom.

Die
Nacht geht so, Frühstück gibt es keines. Wir kaufen etwas Brot in der Stadt und
fahren los. Es gibt zwei Wege nach Mali. Eine große Piste, die jetzt natürlich
ebenfalls Baustelle ist und eine kleine Piste, die in Nigernähe entlang führt
und nicht von Lastwagen benutzt wird. Diese wird uns von den Jungs aus dem
Hotel empfohlen. Der Weg führt durch eine Tiefebene des Niger. Zu beiden Seiten
des Weges erkennen wir Baumwollfelder, die gerade frisch verbrannt wurden, um
Platz für Neues zu schaffen. Uns kommen haufenweise Radfahrer entgegen, die den
Markt von Siguiri ansteuern. Irgendwann kehrt sich die Richtung um, und wir
überholen viele Radfahrer, dann nähern wir uns dem nächsten Markt bzw. dem
nächsten Dorf. So wissen wir anhand der Radfahrer immer wann wieder ein Dorf
kommt.